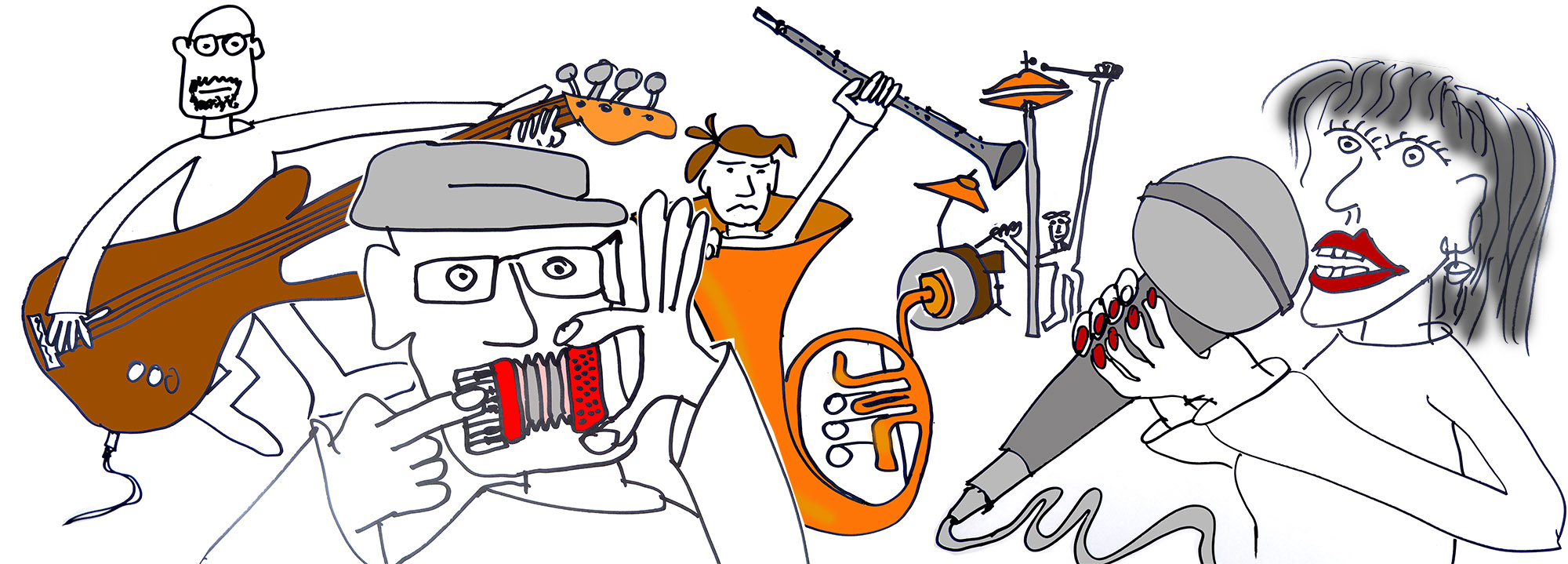In meinen neuen, etwas zu steifen Birkenstockhalbschuhen schleppte ich mich über den vertrockneten Bürgersteig der Brunnenstraße, dort wo sie noch zum Wedding gehört. Büffel gab es hier wohl bloß in prähistorischen Zeiten und die Zeit der Kühe ist zwischen den bizarren 80-Jahre-Betonbauten schon lange vorbei. In meiner wasserdichten Umhängetasche aus Funktionsmaterialen finden sich keine Lebensmittelvorräte, sondern nur Infomaterialien, wie ich meine literarisches Lebenswerk digital veröffentlichen könnte, wenn jemand unerwartet das Bedürfnis artikuliert, dass er es auf Papier gedruckt sehen will.
Archiv 2014 — heute
Akkordeon Salon Orchester übt und übt!

Es geht alles recht langsam voran, darum veröffentliche ich schon mal dieses Bild. Weitere Bilder und vor allem weitere Audioaufnahmen sind in Vorbereitung. Aber das größte Cottbuser Kulturevent im März wird hoffentlich unser Auftritt im Comicaze am 19.3. Bis dann!
Erste Aufnahmen des Akkordeon Salon Orchesters in neuer Besetzung
Schaut doch mal wieder auf der Soundcloud-Seite des Orchester vorbei, da sind jetzt die ersten Lieder mit Bruna und Christian veröffentlicht. Im Lauf der nächsten Wochen werden da noch einige weitere Lieder erscheinen. https://soundcloud.com/multipop-ralf-schuster
Jetzt sind wir auch wieder voll motiviert! Wenn jemanden einfällt, wo wir auftreten können, sollen oder dürfen, der möge sich bitte melden (aso@posteo.de)
Trailer „Einfälle 2016“ jetzt online
[vimeo 153141377 w=500 h=281]
<p><a href=“https://vimeo.com/153141377″>Einfälle Trailer 2016</a> from <a href=“https://vimeo.com/user4502223″>Sebastian Rau</a> on <a href=“https://vimeo.com“>Vimeo</a>.</p>
Mörderenten Weltweit
So, liebe Freunde, der Medialismus-Roman ist schon seit einigen Wochen fertig geschrieben und muss nur noch publiziert und gelesen werden. Ich habe jetzt Zeit, mich verstärkt um das nächste große Werk zu kümmern, um die zehnte Folge der Kommissar-Schlemmer-Kriminal-Kurzfilme. Unter dem Arbeitstitel „Mörderenten Weltweit“ soll dieser Film mit der angestrebten Länge von sage und schreibe 45 Minuten im Frühling und Sommer 2016 entstehen. Das Konzept wollen wir am 19.3. um 20:15 im Comikaze vorstellen. Wer Interesse hat, kann sich für eine wichtige Nebenrolle als Leiche, Schaulustiger oder Rumsteher vormerken lassen.
Zur Einstimmung und zur Ausstimmung wird es weitere Filme und Musik geben, zum Beispiel „Wohnung frei im Plattenbau“, das letzte wichtige Werk und natürlich mit dem Akkordeon Salon Orchester.
Medialismus Teil V (Internet)
Zum Teil 1 __ Teil 2 ___ Teil 3 ___ Teil 4
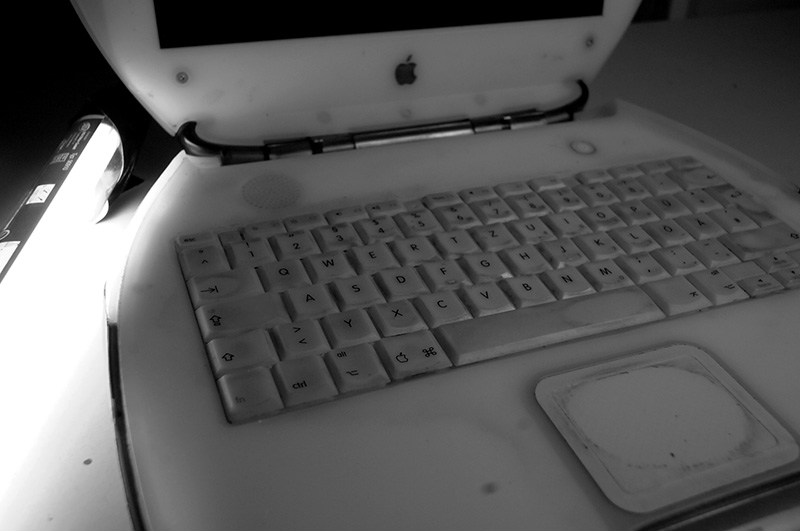
37.
Noch bevor Tina aus Australien zurückkehrte, begann in der Provinzstadt mein Angestelltenverhältnis. Wie sie mir aufgetragen hatte, besorgte ich mir eine eigene Wohnung, allerdings nicht in Berlin. Die Wohnung war ziemlich schäbig und schlecht zu beheizen, aber das störte mich erst einmal nicht. An der Universität gab es für mich mehrere kleine Räume und einen Keller, in denen all die Sachen untergebracht waren, die ich für meine Filme brauchte. Natürlich sollte ich diese Technik nur betreuen oder vielmehr die Studenten betreuen, wenn sie die Technik benutzen wollten, aber niemand hielt mich davon ab, wenn ich mich selbst betreute.
Medialismus, Teil IV (Video digital)
Ralf Schuster singt im Hotel Pritzren
Galerie Fango, 6.11.2015 im Rahen des Cottbuser Filmfestivals.
Filmstudierende aus Berlin hatten die Ergebnisse ihrer Summerschool in Pritzren/Kosowo in der Galerie Fango präsentiert und zu diesem Anlass das Hotelzimmer aufgebaut. Ralf Schuster sang einige Lieder zur Rhythmus Box und zeigte den aktuellen Film Zimmer frei im Plattenbau
Medialismus, Teil 3 (16mm)
18
Der Winter kam und das Leben wurde anstrengender. Mit dem Fahrrad zwischen Stadt, Bahnhof und Dorf hin und her zu fahren machte bei Kälte keinen Spaß und wenn ich dann nach Hause kam, war es ungemütlich, weil unser Gehöft nur in der guten Stube und in der Küche ordentlich zu beheizen war. Obwohl die Arbeit den Reiz des Neuen inzwischen verloren hatte, empfand ich es als spannende Herausforderung, die reale Welt mit der Kamera so einzufangen, dass ich dies als ästhetische Aufwertung sah. Also, vereinfacht gesagt: Wenn meine Bilder schöner waren, als die Realität, dann war ich zufrieden. Das ist Jahrzehnte später immer noch die gleiche Problemstellung und es bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, an der man sich beweisen kann und die mich immer noch beschäftigt. Aber zum Glück nicht in der Fließbandarbeitsweise wie damals beim Lokalfernsehen, wo ein Termin den nächsten jagte. Wo die Mitarbeiter ständig wechselten. Wo man es kaum schaffte, eine private Verabredung einzuhalten, weil so oft unerwartete Termine dazwischenkamen.
In unserer Scheune war immer noch kein Kulturzentrum entstanden, aber ein notdürftig eingerichteter Proberaum, in dem Gitarren-Hans mit Tina und einigen anderen Musikern eifrig übte. Die Akustikgitarre hatte Hans an den sprichwörtlichen Nagel gehängt, er sang jetzt in Englisch und Tinas Brumm-Synthie passte nicht so richtig zum restlichen Sound. Da gab es dann immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden, was aber bestimmt nicht nur am Sound lag, sondern vermutlich an der ungeklärten Hierarchie, wer diesen Sound zu bestimmen habe. Wenn eine Beziehungskrise angesagt war, kam Tina abends zu mir und wir unterhielten uns über die Welt und andere Banalitäten. Wenn es hingegen gut mit den beiden lief, sah ich sie oft tagelang gar nicht. Als es im Januar und Februar noch kälter wurde, wollte niemand mehr in der Scheune proben, und Tina blieb oft mehrere Tage lang in der Wohnung von Gitarren-Hans. In der Szenekneipe lies ich mich mit beginnendem Frühling nicht mehr blicken, weil die blonde Bedienung die Nase voll von meiner Unverbindlichkeit hatte. Sie fragte mich an einem Abend ganz unerwartet, was ich von ihr will und weil mir keine romantische Antwort einfiel, schwieg ich. Daraufhin holte sie sich ihre Zahnbürste aus dem Bad und ging. Vielleicht schlief sie jetzt mit einem anderen oder verzichtete erst einmal auf Sex. Ich verbrachte also viele Abende allein in unserem Gehöft.
Wenn ich mich an die Schreibmaschine setzte, um etwas Geistreiches oder Konzeptionelles zu schreiben, fielen mir meist nur unzusammenhängende Kleinigkeiten ein, es fehlte entweder an Konzentration oder an Inspiration. Darum zeichnete ich viel, zeichnete Blatt für Blatt eines kritzeligen Animationsfilmes. Das war nach der anstrengenden Arbeit beim Lokalfernsehen eine gute Entspannung. Beim Zeichnen musste ich ab und zu eine neue Szene entwerfen, das war der anstrengende Teil, aber danach vergingen etliche Stunden oder Tage mit der routinehaften Ausarbeitung. Ich zeichnete mit Füller und verwendete Schreibmaschinendurchschlagpapier, das damals noch überall billig zu haben war. Weil das Papier so dünn war, wuchs der Stapel mit den fertigen Bildern sehr langsam.
Nebenbei hatte es geklappt, einige Filmabende mit Lesung zu organisieren, also eine Mischung aus meinen Filmen und Texten. Die Idee dazu war mir gekommen, weil mir der „Falsche Film“ fehlte. Das Filmprogramm mit denjenigen Filmen, die mir gefielen und gut zusammenpassten, war zu kurz. Dann stellte sich heraus, dass meine Kurzgeschichte, die sich mit dem unrühmlichen Ende des Filmes beschäftigte und die Auszüge aus dem Drehbuch, die ich vortrug, viel besser beim Publikum ankamen als der Film selbst.
Durch Zufälle ergab es sich, dass ein Kontakt nach Berlin zustande kam, genau zu jenem Hinterhofkinoprogrammdirektor, der in Martins Anwesenheit den Verlust des falschen Filmes mit Krokodilstränen beweint hatte. Ich lernte seine Schwester bei einer meiner Lesungen mit Filmvorführung in Süddeutschland kennen. Wir unterhielten uns nach meinem Programm angeregt über meine, und dann über die damals angesagten intellektuellen Filme, die ich zum größten Teil nicht gesehen hatte, über die ich aber trotzdem genügend wusste, um mitreden zu können. Schließlich versuchte ich das Gespräch so zu lenken, dass sie mir ihre Telefonnummer geben würde, aber dann erwähnte sie das Hinterhofkino ihres Bruders in Berlin und letztendlich kam ich in beiderlei Hinsicht voran: mit ihr traf ich mich danach immer wieder in unserem ambitionierten Kleinstadtkino und gleichzeitig vermittelte sie mir den Kontakt zu ihrem Bruder, was bewirkte, dass wir einen Filmabend an einem Samstag im Sommer organsierten. Als der Termin festgelegt war, ging ich gleich zum Chef und sagte, dass ich an dem Wochenende auf keinem Fall arbeiten könne, irgendwann muss man auch mal Urlaub haben. Er nickte nur und tat so, als würden wir doch sowieso frei über unsere Zeit verfügen. Inzwischen war ich seit fast einem Jahr dabei, hatte noch eine zweite Lohnerhöhung bekommen und gehörte wegen der hohen Fluktuation tatsächlich schon zum angestammten Personal.
Diesmal wollte ich mit dem Zug nach Berlin fahren, denn die Autobahnstrecke durch die neuen Bundesländer entwickelte sich gerade zur Endlosbaustelle und Trampen verlor zunehmend an Sozialprestige, was mich nicht weiter gestört hätte, aber da ich gleich am Freitag nach der Arbeit los wollte, bot es sich an, mit dem Bummelzug zu starten und dann in einen Nachtzug umzusteigen, der von München nach Berlin fuhr. Damals gab es in den sogenannten D-Zügen sechssitzige Abteile, die man zu einer großen Liegewiese zusammenschieben und dann die Vorhänge zuziehen konnte. Wenn man eines der Abteile ergattert hatte, war das Reisen sehr komfortabel. Aber zunächst standen Tina und ich ratlos im Flur. Wir zogen einige Türen auf, aber in jedem Abteil kauerten entweder südeuropäisch wirkende Großfamilien oder bunt zusammengewürfelte Reisegruppen. Platz gab es für uns anscheinend keinen. Schließlich setzten wir uns in den Flur auf die Klappsitze und rauchten erst einmal.
Tina Entschluss, mich zu begleiten, war schnell und spontan gefasst worden. Am Mittwoch hatte sie mich gefragt, was ich am Wochenende tun wolle, am Donnerstag sagte sie mir, dass sie mitkomme. Sie werde bei einer alten Freundin übernachten und gemeinsam mit der Freundin wolle sie zu meiner Filmvorführung kommen, da sie nur ein paar Straßenecken entfernt vom Hinterhofkino wohne und selbst auch einen Film zu drehen beabsichtige. Dann soll sie es versuchen, sagte ich mit leichter Boshaftigkeit. Womöglich war es eine von denen, die glaubten, sie müssten die Kamera nur in die Hand nehmen und könnten dann alles besser. Nein, das würde ihre alte Freundin bestimmt nicht denken, sie wisse ja nicht mal, wie die Kamera funktioniere, und Tina solle mich mitbringen, weil sie erstmal herausbekommen müsse, was da für Filme rein gehörten. Oh Gott, die weiß also gar nichts, da muss sie sehr hübsch oder sehr nett sein, damit ich sie in die Geheimnisse des filmischen Filmens einweihe. Das ist sie, beteuerte Tina, ohne auf meine Provokation einzugehen, und sie, Tina, würde dann ja Kamera führen, wenn ich herausgefunden hätte, was für ein Format es sei. Aha, und wann soll das alles stattfinden, vor allem wo, und mit wem?
Mal sehen, sagte Tina, dann musste sie aufstehen, ein schlaksiger junger Kerl mit wirren Locken und einem riesigen Rucksack wollte an uns vorbei. Hinter ihm seine kleine Freundin, die den größeren ihrer beiden Rucksäcke auf dem Rücken und den kleineren vor dem Bauch trug, außerdem noch eine Jutetasche in der Hand. Obwohl sie kaum durch den engen Gang passte, schaffte sie es dann doch, sich an uns vorbeizuquetschen. Tina wollte sich schon wieder auf den Klappsitz fallen lassen, aber erst einmal mussten wir prüfen, wo die beiden herkamen. In der Tat stellte sich heraus, dass sie ein ganzes Abteil für sich alleine gehabt hatten, alle Sitze zusammengeschoben, die Gardinen zugezogen. Wir sprangen schnell rein. Als der Zug am Bahnhof hielt, lagen wir unter unseren Schlafsäcken und taten so, als seien wir schon seit Stunden im Tiefschlaf. Es stiegen nur wenige Reisende ein, niemand interessierte sich für unser Abteil und so blieben wir allein.
Wir hätten die besten Bedingungen gehabt, gut zu schlafen, ohne Aufpreis und ohne Reservierung, aber wir taten es nicht, stattdessen beschwerte sich Tina darüber, dass unser Leben auf dem Land langweilig sei, dass sie keine Lust mehr hätte, an der Theke meiner ehemaligen Lieblingskneipe zu stehen und den völlig verblödeten Trinkern, die dort allabendlich herumlungerten, ihre traurigen Dorfalltagsneurosen zu therapieren, dass ihr auch Gitarren-Hans eigentlich am Arsch vorbeiginge. Seine selbstgefällige Weltverbesserungsinszenierung diene nur seinem auf Dur und Moll getrimmten Ego, aber sie würde sich ja immer in die falschen Typen verlieben, die falschen Freunde haben, Freunde, die entweder teilnahmslos und antriebsschwach wären, oder angepasste Spießer und eigentlich sei ich es doch gewesen, auf den sie immer ihre Hoffnung gesetzt hätte, ich und meine Filme, da wäre doch so viel Wahrheit drin gewesen, in den Dialogen, wenn man genau hinhöre und sie verstehe. Vieles sei ja einfach nur Unfug und witzig, aber sie habe die Filme schon so oft gesehen, sie wisse, dass da mehr drinstecke als eine billige Aneinanderreihung von Gags, das sei nicht nur Komikerhandwerk, wie es die Unterhaltungs- und Fernsehbranche tagtäglich ausspucke. Die Filmemacher, die Filme fürs Fernsehen oder fürs Kino machten, seien ja, mit wenigen Ausnahmen, nur Handwerker, die ihr Handwerk dazu benutzten, den emotionalen Gaumen der Zuschauer im richtigen Rhythmus zu kitzeln, eine Prise Humor, ein bisschen Gesellschaftskritik und ein fetter Batzen Spannung, oder, noch schlimmer, „Action“, das sei doch alles nur eine industrielle Instrumentalisierung unserer Gefühle, um uns dann ein Happy End überzustülpen wie wärmende Filzpantoffeln.
Sie habe es so sehr genossen, als Martin in der „Rückbesinnung“ den schönen Satz: „Was ich nicht bemerke, gibt es nicht.“ gesagt habe. Das werde mich vielleicht wundern, dass gerade dieser Satz solch eine Wirkung auf sie gehabt habe, aber es sei nicht der einzige gewesen, viele Sätze in meinen Filmen schienen ihr wie eine Öffnung aus der Scheinwelt, in der wir behütet und ruhiggestellt vor uns hinlebten, hinein in eine andere Welt, die eine Essenz dessen sei, was wir fühlten, was wir liebten, was uns in den Wahnsinn treibe, diese Gefühlsverwirrung, die wir für das einzig Erstrebenswerte hielten. Lieber ein vergeblicher kreativer Kampf, als diese Konsumendlosschleife, in die wir langsam aber sicher hineindriften, unauffällig aber ungebremst. Wir müssen die Reißleine ziehen! Wie soll denn das gehen, das ist doch völlig irreal, das ist doch esoterisch, warf ich ein, doch sie war nicht zu bremsen, das muss gehen, mit echter Emotionalität! Das muss es gar nicht! Sie widersprach hartnäckig. Sie glaube nicht, dass ich nicht daran glauben würde. Oder hast du schon alles vergessen? Was sollte ich vergessen haben? Ich wusste es nicht, ich wusste gar nicht, was ich glaubte, und was nicht. Aber Tina brach die Diskussion ab, drückte ihren Körper an meinen und küsste mich.
Unsere Zungen umschlangen sich, als könnten sie die mangelnde Übereinstimmung unserer Gedanken wieder wettmachen, die Hände schoben sich unter die Unterhemden, in die Unterhosen. Tina hatte einen unvorstellbar sanften Hintern, der sich fantastisch anfühlte. Sie küsste mich immer noch leidenschaftlich und ich dachte mir, dass wir jetzt miteinander schlafen müssten, denn es könnte sein, dass sich nie wieder im ganzen Leben die Gelegenheit bieten würde, im Zug Sex zu haben und alle davorliegenden Gelegenheiten, es waren ganz wenige, hatte ich ungenutzt verstreichen lassen. Das dachte ich damals, obwohl ich gar nicht wissen konnte, dass sich der Schienenverkehr immer mehr zu individualisiertem Reisen in Großraumabteilen entwickeln würde, wo alle nur noch in ihre mitgebrachten Laptops und Tablets hineinschauen. Was Tina dachte und wollte, versuchte ich zu verstehen, doch ich kam zu keinem Ergebnis. War es Sehnsucht? Ihre Sehnsucht, der bösen Realitätswelt zu entkommen, die sie in meine Arme trieb? Waren es meine Vorurteile und mein mangelndes Einfühlungsvermögen, die mir die Vermutung nahelegten, Tina beginge gerade den fatalen Fehler, dass sie Liebe als Handlungsoption sah, um der schlechten Welt zu entkommen und dann, wiederum falsch, Sex mit Liebe gleichsetzte? Auch die Liebenden bleiben in der schlechten Welt drin, müssen drinbleiben, es gibt kein Entkommen. Vielleicht leiden sie sogar noch mehr? Aber das waren nur wirre Gedankenfetzen, während ich zur Kenntnis nahm, dass sich nun tatsächlich Sex im Zug anbahnte, der dann etwas fahrig, aber weitgehend ruhig vollzogen wurde. Als sich der Zug verlangsamte und verdächtig viele Lichter vor dem Fenster vorbeihuschten, zog ich mir meine Unterhose wieder an. Das musste mal sein, sagte Tina, und ich rätselte: Musste es mal mit mir oder musste es mal im Zug sein?
19
Weil unser Zug früh um sieben ankam, und ich Martin, den notorischen Langschläfer nicht wecken wollte, begleitete ich Tina zu ihrer „alten“ Freundin, die auffallend klein und ein paar Jahre jünger war als wir. Sie hieß ebenfalls Tina. Die beiden kannten sich aus irgendeinem gemeinsamen Urlaub und durch die danach geführte Brieffreundschaft. Die kleine Tina öffnete uns die Tür mit betont müdem Blick, bekleidet nur mit einem riesigen Schlaf-T-Shirt. Gleich beim Kaffeetrinken kamen wir auf die Kamera zu sprechen. Die kleine Tina verschwand kurz in ihrem Zimmer. Als sie zurückkam, brachte sie eine Ledertasche mit, die unten flach, aber oben halbkreisförmig abgerundet war und ausgesprochen elegant aussah. Jetzt hatte sie sich eine schwarze Strumpfhose angezogen, im Schneidersitz saß sie auf dem Stuhl, die Tasche auf ihrem Schoß. Sie gehörte zu den Frauen, die in der Küche nicht auf dem Stuhl sitzen, sondern kauern, also immer mindestens ein Bein auf der Sitzfläche ablegen, aber meistens beide.
Sie öffnete die Tasche mit einem breiten Grinsen, das uns auf die Überraschung vorbereiten sollte und sagte, was sie gerade tat. Also: Ich öffne jetzt die geheimnisvolle Ledertasche. Ihr könnt aber nichts sehen, denn die geheimnisvolle Kamera ist in einem schwarzen, samtenen Tuch eingeschlagen. Dann holte sie die eingeschlagene Kamera heraus und faltete feierlich das Tuch zurück, immer noch mit Erklärungen wie im Kindertheater. Dann hob sie die letzte Ecke des Tuches und vor uns blitzte eine Beaulieu-Kamera im Licht der Küchenlampe. Die Kamera sah so funkelniegelnagelneu aus, dass die große Tina und ich wirklich staunten, zumal das fremdartige, französische 60er-Jahre-Design den totalen Gegensatz zu meinen beiden eckigen Super-8-Kameras, aber auch zu allen anderen Geräten und Dingen darstellte.
Darf ich? fragte ich nach einer angemessenen Bewunderungspause, streckte die Hand aus, nahm ihr die Kamera ab. Sie war ganz schön schwer. Das bestätigte meinen Verdacht. Und was muss da nun rein? Normal oder Super? Nichts von beiden! Noch zweifelte ich an meiner Vermutung, weil ich mich mit den französischen Kameras nicht auskannte, aber dann öffnete ich vorsichtig den Deckel und sah die Spule und die Perforationsgreifer vor mir. Das war weder Super- noch Normal-8, sondern eine 16-mm-Kamera. Beim genauem Hinsehen konnte man ja auch lesen, dass die mit elegant geschwungenen Plastikbuchstaben angebrachte Bezeichnung der Kamera Beaulieu 16R hieß.
Was bedeutet das? fragte Tina etwas verzagt, offensichtlich eingeschüchtert von meinem bedeutungsschwangeren Tonfall. Ist das gut oder schlecht? Sie zog beide Knie vor die Brust, zündete eine Zigarette an, ihr Blick pendelte zwischen mir und der Kamera hin- und her. Das ist toll! sagte ich, da kann man eine viel bessere Qualität erzielen als mit Super-8. Dabei betastete ich die schönen, blitzenden Transporträder des Kameralaufwerkes. Tinas Großonkel, aus dessen Nachlass die Kamera stammte, hatte sie offensichtlich so gut wie nie benutzt. Die simple, aber präzise Mechanik versetzte mich in Euphorie, zumal ich mich an den schmerzlichen Totalverlust meines falschen Filmes erinnerte. Super-8-Material ist Umkehrfilm, so wie eine Dia, erklärte ich. Wobei die Bezeichnung Umkehrfilm irreführend ist, denn im Umkehrfilm ist nichts umgekehrt, sondern alles ist richtig herum, umgekehrt wird nur das Negativ. Die kleine Tina stülpte ihr T-Shirt über die Beine und zog die Arme durch die Ärmel an den Körper, so dass sie unter ihrem großen Schlaf-T-Shirt wie unter eine Plane versteckt war. Ich überlegte, wie ich meine Erklärungen beginnen sollte, damit die beiden Tinas verstehen könnten, worauf ich hinauswollte. Deshalb versuchte ich es nochmal ganz langsam: Wenn man einen sogenannten „normalen“ Film entwickelt, dann erhält man das Negativ und das Negativ ist der Film, der tatsächlich in der Kamera drin war. Von diesem Negativ macht man Abzüge, die wiederum negativ zum Negativ sind, also positiv. Beide Tinas nickten. Beim sogenannten Umkehrfilm wird ein anderer chemischer Entwicklungsprozess angewandt, der das Material, das in der Kamera war, direkt zum Positiv entwickelt. Der Super-8-Film, der zunächst in der Kamera belichtet wird ist derselbe, der später im Projektor an die Wand geworfen wird. Ein Unikat, und deshalb hat man gar nichts mehr, wenn der Film verlorengegangen ist, nur die Erinnerung.
Für die kleine Tina erzählte ich ausführlich die Geschichte von Martin, dem die Tüte mit meinem falschen Film in Berlin verlorengegangen war, wobei Martin vermutlich sogar direkt vor Tinas Haus vorbeigekommen sein musste, da sich das Hinterhofkino nur ein paar Blocks weiter befand und natürlich, so erzählte die kleine Tina, schaue sie dort immer wieder absonderliche Filme, die sonst nirgendwo zu sehen seien. Mit betroffenem Gesicht hörte sie sich an, dass mein Film rückstandslos für immer verschwunden sei. Dann stand sie auf, nahm sich die Strickjacke aus dicker Wolle vom Haken an der Küchentür, zog sie an und verschwand fast darin. Ich blickte wieder auf die 16-mm-Kamera, die ich immer noch geöffnet auf den Oberschenkeln liegen hatte, spielte mit dem kleinen Türchen für die Bildfensterabdeckung, zeigte den beiden Frauen diesen Mechanismus, was sie in Staunen versetzte und die Stimmlage meiner Erklärungen wurde wieder euphorisch. Mit 16 mm wäre der Totalverlust nicht passiert! Zwar gibt es auch 16mm-Umkehrfilme, aber die werden selten benutzt. Als Filmemacher dreht man auf Negativfilm. Der fertige Film, der vorgeführt wird, ist dann nur ein Abzug des geschnittenen Negativs und wenn er verlorengeht, dann zieht man eine neue Kopie in der gleichen, hohen Qualität. Je länger ich redete und gleichzeitig mit spitzen Fingern die Mechanik der Kamera befühlte, die verschiedenen Knöpfe und Regler untersuchte, desto mehr reizte es mich, mit dieser Kamera zu arbeiten und Schluss zu machen mit dem popeligen Herumgefingere an diesen winzigen Super-8-Bilderchen.
Schon als ich die Projektion mit der 16-mm-Filmschleife im Hof vorbereitet hatte, faszinierte mich, dass die einzelnen Bilder bei 16 mm groß genug waren, um sie mit dem bloßen Auge gut zu erkennen, während das Hantieren mit Super-8 immer etwas Grenzwertiges hatte, das Gefühl vermittelte, mit einer Notlösung, mit einer Minimalanforderungstechnologie zu arbeiten. Der Projektor auf unserem Gehöft war eine alte, verstaubte Kiste gewesen, als wir ihn fanden. Trotzdem hatte es mich begeistert, das Surren des Motors und das Klackern der Mechanik zu hören. Aber die blitzende Kamera, die ich jetzt in der Hand hielt, faszinierte mich noch viel mehr.
Rückblickend muss ich sagen, dass ich die beiden Tinas im Überschwang auf geradezu unverschämte Weise zutextete und das nicht einmal uneigennützig. Der gesamte Produktionsprozess in 16 mm sei aufwändig, begann ich meine Erläuterungen, denn vom Negativmaterial werde eine sogenannte Arbeitskopie gezogen, das sei eine billige Kopie ohne Helligkeits- oder Lichtkorrektur, die Arbeitskopie sei für den Cutter, an ihr werde rumgeschnitten, und zwar nicht nur weggeschnitten wie bei Super-8, da könne man dann auch wieder was hinschneiden und einen schlechten Schnitt rückgängig machen, was bei Super-8 de facto nicht gehe, aber eine riesige Unzulänglichkeit sei. Habe man dann die Arbeitskopie zu einer Sequenz zusammengeschnitten, die der eigenen Vorstellung vom Film entspreche, dann werde das Negativ von Spezialisten im Kopierwerk genauso geschnitten, wie es die Arbeitskopie vorgebe. Von dem geschnittenen Negativ könne man eine Kopie ziehen, die aus einem Stück bestehe. Wenn genug Budget vorhanden sei, mit Farbkorrektur. Farbkorrektur bedeute, dass im Kopierprozess vom Negativ zur Vorführkopie Farbfolien eingeschoben würden, die die Farbigkeit veränderten, also könne man zum Beispiel das Bild wärmer machen, womit man ein eher rötliches Bild meine, oder kälter, das bedeute bläulich. Auch die Helligkeit des Bildes sei bei der Kopie beeinflussbar. Negativmaterial sei sehr tolerant und habe viele Reserven, was die Belichtung angehe, sagte ich mit Begeisterung, obwohl ich es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht ausprobiert hatte, sondern nur aus Büchern kannte.
Trotzdem steigerte ich mich in eine redselige Techniklobpreisung hinein, während die kleine Tina feststellte, dass sie sich wohl verkühlt hatte und ein Tuch um ihren Hals wickelte. Dann schnäuzte sie sich und fragte, wo sie denn nun so einen Film kaufen könne und wo sie dann damit hingehen müsse, wenn sie diesen Negativschnitt und die Farbkorrektur und all das, was ich da eben erzählt hätte, haben wolle. Und was das dann koste. Während ich großspurig eine umfangreiche Kalkulation für einen Zehnminüter runterspulte, bei dem sich etliche Kostenpunkte im dreistelligen Bereich bewegten, da verschwand die kleine Tina endgültig in ihrer großen Strickjacke und machte sich nur durch gelegentliches Schnäuzen ins Papiertaschentuch bemerkbar.
Ich kam dann auf eine Endsumme von über tausend DM, reine Materialkosten, betonte immer wieder, dass das sehr knapp kalkuliert sei, aber vermutlich hörte Tina gar nicht mehr richtig zu. Schließlich fragte sie, wo an der Kamera eigentlich das Mikro sei. Da konnte ich nochmal mit meinem Fachwissen aufdrehen: Mikro? Das gebe es da nicht, das sei doch bekannt, dass chemische Filmaufzeichnungsverfahren „stumm“ seien, wie die Fachleute sagen. Für den Ton sei eine völlig separate Aufzeichnung notwendig, aber da diese äußerst schöne Beaulieu den großen Vorteil habe, dass die Bildgeschwindigkeit stufenlos sei, was sowohl Zeitraffer als auch Zeitlupe ermöglichen würde, sei sie leider nicht „gequarzt“ und Filmaufnahmen, die von Kameras mit ungequartzem Motor stammten, könne man ja gar nicht ordentlich mit dem Liveton synchronisieren. Was den Ton anginge, stünde man mit der Beaulieu 16R genauso schlecht da wie beim Super-8-Film, man müsse alles komplett nachvertonen.
Während mir selbst klar wurde, dass ich in unmittelbarer Zukunft unbedingt auf 16 mm drehen musste und zwar genau mit dieser Kamera, war für die kleine Tina der Traum vom eigenen Film mit der eigenen Kamera erst einmal geplatzt. Ich gab ihr noch einen kleinen Abriss, wie teuer das gleiche Filmprojekt in Super-8 sein würde. Auch da staunte sie, aber natürlich konnte sie es sich eher vorstellen, zweihundert Mark auszugeben als eineinhalbtausend. Sie gab sogar zu, dass sie eineinhalbtausend Mark bereit liegen habe, weil sie nach Indien fliegen wolle, für vier Wochen, und wenn sie wählen müsse zwischen Indien und einem zehnminütigen Film, da sei doch alles klar, da gäbe es keine Zweifel, da fliege sie nach Indien. Ich nicht, sagte ich!
Nachdem sie sich eine weitere Packung Papiertaschentücher geholt hatte, traute ich mich, die gewagte Frage zu stellen: Ob sie nicht einfach die Kamera mit mir tauschen wolle, ich gäbe ihr eine von meinen Super-8-Kameras, lege noch einen Stapel Filmkassetten dazu, genug, um das Projekt durchzuziehen und ich bekomme die Beaulieu. Wobei ich noch testen müsse, ob die Beaulieu wirklich funktioniere. Auch wenn sie funkele, sei nicht klar, ob Motor und Akkus noch in Schuss seien. Die große Tina schaute mich skeptisch von der Seite an, während die kleine Tina zu glauben schien, was ich ihr eingeredet hatte: dass meine alte, praktische Super-8-Kamera genau das richtige Rettungsboot sei, mit dem sie ihre ambitionierten Nachwuchsfilmemacherinnenpläne ins Trockene bringen konnte. Außerdem kennt sich Tina mit meiner Kamera aus, sagte ich, und das bestätigte die große Tina, so dass die kleine Tina weich wurde und einwilligte. Ich gratulierte ihr herzlich zu dieser Entscheidung und sang noch ein kurzes Loblied auf Super-8. Inzwischen war der Vormittag fast vorbei.
Ich hängte mir die elegante Kameratasche mit ihrem wertvollen Inhalt über die Schulter, bedankte mich bei der kleinen und umarmte die große Tina, dann ging ich nach draußen, wo ein paar schräge Kreuzberger Gestalten meinen Weg kreuzten. Dann eine türkische Familie. Und zwei Frauen über 30, mit asymmetrischen Frisuren, die typischen schwarzen Klamotten, schick, aber nicht sexy, die sahen aus, als ob sie im Kreativbereich arbeiteten würden. Vielleicht wussten sie, was es bedeutet, eine 16-mm-Kamera in der Tasche bei sich zu tragen. Hoffte ich im Stillen, während ich durch die Straße lief und dabei darüber nachdachte, wieso man mich, speziell mich, toll finden könnte. Meine Phantasie lieferte zu diesem Thema viele sehr exotische Lösungen. So eine Kamera war, verglichen mit dem, was mir sonst einfiel, eine geradezu realistische Erklärungsoption für meine genialische Besonderheit.
Da ich sowieso nur noch eine Häuserecke vom Hinterhofkino entfernt war, ging ich hin. Wie erhofft, war der Hinterhofprogrammdirektor gerade da, er musste putzen und aufräumen. Ich stellte mich vor und band ihm sofort auf die Nase, dass ich gerade ein Schnäppchen gemacht hatte. Ihn konnte ich mit der Kamera richtig beeindrucken. Auch er befühlte die blitzende Mechanik der Transportrollen und des Bildfenstertürchens. Aus dem Nachlass des Großonkels der Freundin einer Freundin, sagte ich. Verschwieg, dass ich die Kamera der Besitzerin abgeschwatzt hatte. Dann tranken wir Kaffee und redeten über den bevorstehenden Abend. Telefonisch wollte ich Martin meine Ankunft anmelden, der aber beschloss, direkt ins Kino zu kommen, da er in der Nähe zu tun habe.
Während ich mit dem Hinterhofkinoprogrammdirektor das Kino für den Abend vorbereitete, was letztendlich nur darin bestand, dass wir einen Tisch mit Leselampe vor die Leinwand rückten, kam auch schon Achim an. Er begrüßte mich, wie ich es nicht anders erwartet hätte, überschwänglich und mit dick aufgetragenem übertriebenem Lob. Der wichtigste Filmemacher des Untergrunds sei endlich da, wo er hingehöre, in Berlin, sagte er, machte dann aber auch gleich noch die Bemerkung, dass drüben, auf der anderen Seite der Spree, im Osten, alles viel spannender und aufregender sei als hier, wo der Subkulturbetrieb von spießig gewordenen Kriegsgewinnlern des Häuserkampfes oder verbohrten Linksideologen gerade zu Grabe getragen würde. Von der eigenen Polemik erheitert lachte Achim laut, während der Hinterhofkinoprogrammdirektor überlegte, ob er sich angegriffen fühlen sollte. Inzwischen hätten sich die Hausbesetzer in Hausbesitzer verwandelt, damals vom Sozialismus geredet und jetzt verdienten sie sich eine goldene Nase mit Seminarräumen und Computerpools, die sie für vom Arbeitsamt finanzierte Umschulungen vermieteten. Achim war gleich voll in Fahrt, aber hatte ich nicht anders erwartet. Später erfuhr ich, dass seine Wohnung auch einem Vermieter dieser Kategorie gehörte und weil Achim immer seine eigene Meinung durchsetzen zu müssen glaubte, war er mit ihm heillos zerstritten, tat aber so, als läge das ausnahmslos an den charakterlichen Defiziten des Vermieters. Die Kunst, pointiert über alles und alle herzuziehen, über das Establishment, über das alternative Establishment, über die Hochkultur und die Subkultur, über Bürokratie und Funktionäre, beherrschte Achim meisterhaft, so dass ich seine Schimpftiraden über die Berliner Verhältnisse sehr genoss, zumal er oft genug unvermittelt in maßlose Anpreisungen meiner kulturellen filmischen Leistungen wechselte.
Ich hatte einen Teil meines Gepäcks im Hinterhofkino gelassen und wir spazierten durch eine wunderbar sommerliche Stadt zur Brücke, um in die sensationelle Ruinenlandschaft des kollabierten Sozialistenterritoriums, wie Achim es bezeichnete, zu gelangen. Martin hatte Achim zu mir ins Hinterhofkino geschickt, weil er selbst gleich zu einer gerade zugänglichen Industrieruine fahren wollte. Dort sollten wir uns treffen. So krochen Achim und ich zwischen baufälligen Gemäuer herum, über ein paar kaputte Zäune, dann durch ein kaputtes Fenster in die Halle, die voller riesiger Maschinen stand. Dort machte Martin mit Stefan und zwei Blondinen in Arbeitsoveralls Videoaufnahmen. Ein Projekt für ihre Kunstakademie und ich bekam auch einen Overall, wurde auf einem rostigen Laufsteg hoch oben über den Kesseln gefilmt, wo sich außer mir keiner hoch traute. Eine erkennbare Handlung schien der Film nicht zu haben, aber er war ästhetisch sehr ambitioniert. Da in den folgenden 15 Jahren jeder Nachwuchsregisseur mindestens einen existenzialistischen Kurzfilm in einer DDR-Industrieruine drehte, kann man nicht unbedingt von einer originellen Idee sprechen, trotzdem machten uns die Dreharbeiten viel Spaß.
Dann packten wir die Technik zusammen, fuhren mit Stefans Auto wieder in den Westen, weil man ja an den Imbissbuden im Osten noch nichts Vernünftiges zu essen bekäme und letztendlich saßen wir den Rest des Nachmittags mit Falafel und Schawarma beim angeblich besten Araber der Stadt. Wir waren in super Laune und freudiger Erwartung des Abends. Ich verspürte gegenüber Martin keinerlei Ärger mehr wegen des verlorengegangenen Films, vielmehr gebrauchte ich sogar die Formulierung, dass er mich von dem falschen Film befreit habe, wofür ich ihm dankbar sein könne. Martin fand diese Antwort befremdlich, schließlich hatte ihm der Film sehr gut gefallen. Dann begeisterte ich mich an den unausgegorenen Ideen, die ich mit der 16-mm-Beaulieu-Kamera realisieren könnte. Martin und Stefan hielten mit ihren Akademieprojekten dagegen und Achim schmiss noch ein paar witzige verbale Attacken gegen das Kulturestablishment in die Runde. Schließlich waren wir alle davon überzeugt, dass unsere Aktivitäten zwangsläufig in die richtige Richtung führen würden.
20
Die beiden Blondinen, die beim Videodreh in der Maschinenhalle dabei gewesen waren, kicherten während meiner Filmvorführung ziemlich oft. Achim fiel mal wieder durch sein polterndes Lachen und Zwischenrufe auf. Die große und die kleine Tina saßen ganz vorn, so dass ich sie gut sehen konnte, aber sie hörten ehrfürchtig zu und ließen sich keine Gemütsregung anmerken. Dahinter eine Gruppe von jungen Männern, von denen ich glaubte, dass sie zu Martin und Stefan und der digitalen Akademie für digitale Künste gehörten. Dann noch einige junge Unbekannte, die gemeinsam saßen und Unbekannte, die schon viel älter waren und einzeln oder zu zweit auf die Sitzreihen verteilt waren.
Wenige Sekunden, bevor ich die Veranstaltung startete, als es im Raum schon dunkel war und ich im Schein meiner Leselampe am Tisch vor der Leinwand saß, huschte noch eine Gestalt zur Tür herein und setzte sich weit hinten hin, dort, wo ich Achim vermutete und nur wenig erkennen konnte. Es blieb bei einer Vermutung, denn es war zu dunkel, als dass ich mir hätte sicher sein können. Egal, ich musste anfangen, las meine erste Kurzgeschichte, löschte dann die Lampe. Das war für den Mann in der Vorführkabine das Signal, den ersten Film zu starten. So ging es immer abwechselnd: Ein Film, eine Geschichte, wobei sich die meisten Kurzgeschichten um Anekdoten rankten, die mit dem Filmemachen zu tun hatten. Der falsche Film wurde mehrmals thematisiert: als Konzept, dann durch Drehbuchauszüge und schließlich durch die traurige Tatsache, dass er verlorengegangen sei. Achims Zwischenrufe sorgten für zusätzliche Lacher.
Gegen Ende brach ich das starre Schema auf, es lief eine Version des Films der vergessenen Dinge, zu der ich einen tiefsinnigen, eher poetischen Text vortrug, der zunehmend in meditative Wiederholungen überging, und dazu mischte sich Tinas Stimme, die von der Tonspur des Films stammte. Schließlich sah man die nutzlosen Dinge gar nicht mehr, sondern nur noch ihre Schatten, bewegte Schatten, verzerrte Schatten, unscharfe Schatten. Es entstanden und zerfielen permanent abstrakte Muster aus schwarzen und weißen Flächen. Ich widerholte in der Schlusssequenz immer wieder den Satz: Das Ende der Dinge ist der Anfang der Gedanken und Tinas Stimme, verstärkt und unterstützt durch einen Halleffekt, sagte: Du kannst dich nicht lösen von dem, was die Welt ist, ohne zu verschwinden. Deshalb verschwinde ich! Jetzt!
Beim letzten Wort ging der Film schlagartig in schwarz über und ich löschte gleichzeitig die Taschenlampe, mit der ich meinen Textzettel spärlich beleuchtet hatte. Es war stockdunkel und still im Raum. Alle waren irritiert, ob ich fertig sei, oder ob noch etwas passieren sollte. Ich hatte mir fest vorgenommen, dass ich die Leselampe erst einschalten würde, wenn der Applaus begann, und fast wäre ich von meinem Vorsatz abgewichen, denn die Stille erschien mir schrecklich lang, aber schließlich begann das Publikum zu klatschen und da schaltete ich das Licht an und verbeugte mich. Der Applaus war herzlich, aber nicht euphorisch. Mir schien es genug, um es als Aufforderung für eine Zugabe zu aufzufassen. Deshalb las ich eine kurze Geschichte und gab dann dem Vorführer das Zeichen, den dafür vorgesehenen Film abzuspielen, „Sulos Tod“, das Original auf Super 8, jener Film, in dem ich eine Mülltonne mit der großen Axt kaputthaue. Die erste Version, die schon zu Beginn meines Studiums entstand, lange bevor ich mich mit Videokameras beschäftigte. Als der Film startete, schlüpfte ich zwischen den Vorhängen hindurch in einen kleinen Backstageraum, von dem aus ich ins Foyer des Kinos gelangte. Sulos Tod war damals aus einer einzelnen Spule Film entstanden, also knapp drei Minuten lang. Als er zu Ende war, schaltete der Vorführer das Licht im Kino an.
Am Tresen der kleinen Bar lehnend, beobachtete ich, wie die Zuschauer herauskamen. Zuerst einer von den älteren Unbekannten, dann trat Sabine ins Foyer. Sie war der letzte Gast gewesen, also doch. Ihr lautes Lachen, an dem ich sie hätte erkennen können, bekam ich erst nach der Vorführung im Foyer zu hören, als ich ihr auf die Schnelle einige meiner Abenteuer beim Lokalfernsehen erzählte. Die Lesung habe ihr gut gefallen, meinte sie, durch die Texte sei ihr aber auch bewusstgeworden, dass die Filme ernster seinen, als ihr das zunächst schien, damals, als wir uns in unserer Universitätsstadt ausgetauscht hätten. Martin und Achim kamen mit Bierflaschen in den Händen zu uns, Anstoßen, Flaschenklappern, Martin und Sabine umarmten sich zur Begrüßung, aber sehr emotionslos, dann gaben die Männer ihre Kommentare ab, vor allem zum letzten Teil meiner Lesung, der Performance mit Tinas Stimme und den nutzlosen Gegenständen aus unserer Scheune. Sie fanden das alle sehr beeindruckend, aber zur Begeisterung fehlte noch ein bisschen. Sabine mischte sich wieder ins Gespräch und meinte, das Ende des Stückes sei noch zu schwach, es passe zwar zum Text, aber trotzdem müsse noch ein Knalleffekt hin, auch wenn ich das Wort Knalleffekt hassen würde, bräuchte ich ihn trotzdem, zur Not solle ich einfach den Zugabenfilm direkt danach abspielen, den Applaus nicht aussitzen, sondern ihm zuvorkommen. Wir konnten nicht darüber diskutieren, weil ein älterer Zuschauer dazu trat und fragte, ob es die Filme auf Videokassette gäbe, was ich verneinen musste, dann kam der Hinterhofkinoprogrammdirektor und klopfte mir auf die Schulter, Martin und Achim verabschiedeten sich von der Clique, die ich für die Studenten der digitalen Akademie hielt und dann besprachen sie, in welcher Bar man sich später treffen könnte.
Endlich hatte ich die Gelegenheit, mit Sabine alleine zu reden. Da konnte ich ihr von meinem Leben auf dem Land erzählen, brachte sie zum Lachen, aber ich merkte, dass sie weg wollte. Und du? fragte ich, um das Gespräch herumzureißen, aber damit gab ich ihr erst recht die Gelegenheit, den Abschied einzuleiten, denn unerwartet heiter erklärte sie mir, dass sie schwanger sei und deshalb dürfe sie ja weder trinken noch rauchen, da sei ihr der Aufenthalt in solchen angenehmen Lokalitäten wie dem Hinterhofkino leider völlig verleidet und die Schwangerschaft sei ein echter Unfall gewesen, der Mann schon über alle Berge, wieder in Afrika, ja, ein Schwarzer, ein toller Typ, aber als Familienvater völlig undenkbar, das müsse sie jetzt alleine durchstehen, wovor sie keine Angst hätte, ihr Masterplan für das Studium sei allerdings total über den Haufen geworfen, zumal das in Berlin doch viel komplizierter sei und nicht so, wie sie es erwartet hätte. Beim Erzählen lachte sie die ganze Zeit, das fand sie alles komisch, als wäre es nur ein Spiel. Mit nicht nachvollziehbarer Heiterkeit erklärte sie mir, dass sie viel besser beraten gewesen wäre, in Süddeutschland schnell fertig zu machen und dann in Berlin einen Doktor dranzuhängen. Nach Möglichkeit eine Dissertation mit Assistentenstelle. Oder in Berlin zu wohnen und sich an einer der vielen Unis in den neuen Bundesländern einen Arbeitsvertrag unter den Nagel zu reißen und sich dann erst schwängern zu lassen. Aber so sei es nun mal nicht gekommen. Tschüss, schönen Abend, ein Küsschen und zu guter Letzt sagte sie noch: Komm doch auch nach Berlin. Sie rauschte davon und ich verbrachte den Rest des Abends mit Martin und seinen Freunden.
Mit dem typisch großstädtischen Selbstverständnis, dass nur das Außergewöhnliche gut genug sei, gingen wir in eine Bar, in der die Studienkollegen von Martin schon warten würden. In der Tat erwies sich die Bar als recht kurios, denn wir stiegen auf einem unbebauten Grundstück durch ein Loch in der Mauer hinein in den Keller eines Altbaus und tranken dort in einem muffigen Raum mit rohen Backsteinwänden an einer zusammengezimmerten Bar einige Flaschen tschechischen Biers. Als wir irgendwann mitten in der Nacht bei Martin ankamen, wollte er mir unbedingt etwas am Computer zeigen, fand es aber nicht, und weil der Computer sowieso schon eingeschaltet war, startete er das Spiel mit der Schlange, die durch ein Labyrinth kriecht, ein Spiel, das wir später immer wieder mal spielten. Als ich es zum ersten Mal in den zweiten Level schaffte, wurde es draußen schon hell. Da immer nur einer von uns spielte, weil wir uns abwechselten, konnte der andere viel erzählen.
Ich glaube, in jener Nacht hörte ich zum ersten Mal den Begriff „Internet“. Weil es mich nicht sonderlich interessierte, konnte ich mir nicht merken, um was es eigentlich ging. Es war eben wieder eine von Martins digitalen Aktivitäten und er benutzte zu viele unbekannte Worte, diese Nerd-Sprache, wobei ich damals noch nicht einmal gewusst hätte, was ein Nerd ist. Wenn ich nüchtern gewesen wäre, hätte ich gefragt, was das alles soll, doch betrunken, mit der Schlange vor mir, die im Labyrinth immer länger wird und bei der man höllisch aufpassen muss, dass sie sich nicht in den Schwanz beißt, nahm ich nur zur Kenntnis, dass Martin etwas über Hyperlinks erzählte, die von irgendwo nach irgendwo führen würden und ich musste dabei an Science Fiction-Groschenromane denken. Dort verschwinden die Raumschiffe in den Hyperraum, um die Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit zu überwinden. Es wird nur die Information übermittelt, beteuerte Martin, keine Raumschiffe und dann scheiterte ich an der entscheidenden Kurve im Labyrinth und die Schlange biss sich mal wieder in den Schwanz. Also wechselten wir, Martin übernahm das Spiel. Weil er besser war als ich, schaffte er drei Levels. Das gab mir Zeit, Anekdoten aus unserem Fernsehsender zu erzählen, dann spielte wieder ich und Martin attackierte mich mit den Begriffen Host, Modem und HTML, Computersprache, die ich mit Widerwillen zur Kenntnis nahm. Martin erklärte mir zwar all diese Begriffe, aber leider mit Worten, die ich auch nicht verstand.
Das kommt mir vor wie im Krankenhaus, sagte ich und überlegte danach, was ich damit überhaupt ausdrücken wollte. Martin sagte nichts, sondern schickte die Schlange um die richtige Kurve und hüpfte dadurch in den nächsten Level. Ich plapperte vor mich hin: Wie eine Intensivstation, künstliche Beatmung mit Kommunikation, Dateninfusion und soziale Quarantäne. Darauf läuft das doch hinaus. Martin verneinte entschieden, aber ohne Begründung, denn er musste sich auf die Steuerung der Schlange konzentrieren. Mir fiel nichts mehr ein. Ich schaute schweigend zu, wie er nochmals einen höheren Level erreichte, dann stand ich auf und rollte den Schlafsack aus. Einmal muss ich es noch probieren, antwortete Martin und startete die Schlange, als ich ihm Gute Nacht wünschte. Er verbrachte wohl noch zwei oder drei Stunden vor dem Bildschirm, aber ich schlief tief und fest.
21
Kaum war ich wieder zurück aus Berlin und für das Lokalfernsehen unterwegs, musste ich ins Rechenzentrum der Universität, weil man dort einen neuen Großrechner einweihte. Die vielen Redner benutzten auffällig oft das Wort Internet und auch die anderen Fachbegriffe, mit denen Martin trotz Betrunkenheit so lässig um sich geworfen hatte, führten die Grußwortredner vom Wissenschaftsministerium ständig auf den Lippen, wobei ihnen diese Anglizismen sichtlich Mühe beim Formulieren bereiteten. Man merkte ihnen an, dass sie gerade Neuland betraten. Nur der Informatikprofessor, der die Rechenmaschine für ein paar Millionen gekauft hatte, schaffte es, eine flirrende Kaskade von Spezialbegriffen mit extremer Selbstverständlichkeit von sich zu geben. Die wichtigen Fremdworte, die mehrmals auftauchten, zogen eine lange Fahne anderer Spezialbegriffe nach sich, was den anwesenden Medienvertretern den Schweiß auf die Stirn trieb. Wie sollten sie das ihren Lesern oder Zuschauern und Zuhörern begreiflich machen? Zumal sie es selbst erst mal verstehen mussten. Auch mir blieb die Einsicht verwehrt, welchen Zweck der Professor mit dem neuen Computer verfolgte.
Wenn ich Martin wieder treffen würde, war eine Fachdiskussion im nüchternen Zustand dringend notwendig, sagte ich mir, aber bis dahin hatte ich genug damit zu tun, die reale Welt mit meiner Fernsehkamera Tag für Tag zu durchstreifen, videografisch zu dokumentieren und damit das große Regal, das in unserem kleinen Sender als Archiv diente, immer weiter zu füllen. Inzwischen stapelten wir die Videobänder auf dem obersten Brett. Ambitionen, ein zweites Regal aufzustellen, verspürte ich nicht. Nicht mehr. Das Wochenende in Berlin hatte seine Spuren hinterlassen, die Welt auf dem Dorf war für mich nicht mehr so wie zuvor. Die Lage zwischen Tina und Gitarren-Hans spitzte sich weiter zu. Vielleicht hing das mit der Sängerin zusammen, die inzwischen in die Band eingestiegen war. Ihr Gesang war eigenwillig, aber sie bewegte auf sehr beeindruckende Weise, wirklich klasse. Tina dagegen stand ja immer nur emotionslos hinter ihrem knatternden Synthesizer, drehte an den Potentiometern oder wartete auf den Einsatz. Nach der Probe stritt sie sich oft mit Gitarren-Hans, da war sie überhaupt nicht emotionslos.
Tinas und mein Entschluss, unsere ländliche Einöde in Richtung Metropole zu verlassen, reifte vermutlich zur gleichen Zeit, aber unabhängig voneinander. Weil wir uns oft tagelang gar nicht sahen oder nicht allein waren, oder dachten, es sei gerade der falsche Zeitpunkt, war es bereits Ende Oktober, als ich ihr sagte, dass ich zum Jahreswechsel abhauen, den Job beim Fernsehen hinschmeißen und nach Berlin ziehen werde. Aber anstatt mir Vorwürfe zu machen, war Tina erleichtert, denn sie hatte bereits mit dem Onkel vereinbart, dass sie im Lauf des folgenden Jahres das Gehöft räumen würde, was sie mir nur aus Mangel an einer geeigneten Gelegenheit noch nicht mitgeteilt hätte, aber jetzt sei ja alles geklärt. Damit brachen die letzten beiden Monate an. Um eine unproduktive Wartezeit zu vermeiden, nahm ich mir vor, meinen ersten 16-mm-Film umgehend zu beginnen, damit nicht nur die vergessenen Dinge, sondern auch unser Dorf, die Landschaft und der Hof festgehalten würden.
Die Schwester des Hinterhofkinoprogrammdirektors sollte mir helfen. Bisher verstrickte sie mich nur in hochintellektuelle Diskussionen über kulturell hochwertige Filme, wobei sie auch vor hochprozentigen Getränken nicht zurückschreckte. Darum sagte ich ihr, es sei höchste Zeit, um von der Theorie zur Praxis überzugehen und zwar sofort! Natürlich könne man das auch im November tun, Grenzerfahrungen mit schlechtem Wetter seien ein Grund, aber kein Hindernis, zumal sie, die Schwester des Hinterhofkinoprogrammdirektors, für mich eine sehr herbstliche Persönlichkeit sei, die genau die richtige Stimmung für den Abschied von den traurigen, abgeernteten Äckern und Wiesen versinnbildlichen könne. Da schaute sie mich sehr entsetzt an, so dass ich schon befürchtete, sie sei beleidigt, aber als ich fortfuhr und ihr erklärte, dass sie vermutlich Fellini mehr als Tarkowski schätzen würde und deshalb nicht empfänglich sei für das Kompliment, das in dieser Charakterisierung stecke, hatte ich sie wieder auf meiner Seite. Mit einigen Verweisen zu Buñuel fanden wir wieder den Konsens in der Diskussion, verwarfen zunächst alle vorherigen Konzepte und entwickelten an einem Wochenende ein neues, und zwar an der Bar unseres gemeinsamen Lieblingskinos. Für mich war alles geklärt, aber sie fragte immer wieder, wann wir am Konzept weiterarbeiten. Das weckte in mir den Verdacht, dass sie wohl nur übers Filmemachen reden wollte. Vielleicht dachte sie ja auch, ich hätte sie nur ins Projekt hineingezogen hatte, weil ich mit ihr schlafen wollte und spekulierte darauf, dass es eine Abkürzung ohne Filmaufnahmen geben könnte. Daraus wurde nichts, ich sagte, wir müssten loslegen und der Film solle „Mein Land im Herbst“ heißen, was später gar nicht stimmte, aber als Argument war es hilfreich. Wir müssen drehen, bevor der Winter da ist, bestimmte ich und legte den zweiten Advent als Drehtermin fest, ein fürchterlicher Tag. Es hatte schon tagelang geregnet und nieselte immer noch. Die Feldwege waren voller Pfützen und die Äcker aufgeweicht. Gitarren-Hans hatte das Glück, dass er in seinen Wanderstiefeln spielen durfte, während die Schwester des Hinterhofkinoprogrammdirektors in ihren coolen Stoffturnschuhen durch den Matsch laufen musste. Bei uns allen bildeten sich Batzen von Dreck an den Füßen, mit jedem Schritt klebte noch mehr feuchter Ackerboden an den Sohlen. Ich wollte ja nur, dass die beiden mit einem Musikinstrument, also sie mit einem Geigen- und er mit einem Gitarrenkoffer, einsam über die Felder wandern, in einer verlassenen Landschaft, die müden Körper nach Möglichkeit über dem Horizont. Diese eigentlich einfachen Aufnahmen erwiesen sich bei den gegebenen Wetterbedingungen als extrem kräftezehrend. Meine beiden Darsteller sahen nicht nur müde aus, sondern total mitgenommen. Es wehte ein Wind, der die feuchten Haare zerzauste, die Klamotten flatterten, die Matschfüße bekamen sie beide kaum noch hoch und ich musste mich, um eine Untersicht hinzukriegen, auf die Knie begeben. Da spürte ich sofort die kalte Feuchtigkeit des Bodens durch die Jeans hindurch, aber die Position war nicht tief genug, also legte ich mich hin, hinein in den Matsch und ich musste dabei aufpassen, die Hände nicht schmutzig zu machen, damit die Kamera sauber blieb. Also stützte ich mich beim Hinlegen und Aufstehen immer mit den Ellenbogen ab, die dabei weit in den Boden einsanken.
Mir gelang eine phantastische Einstellung wie sich die beiden Schauspieler kraftlos näherten und dann, ohne sich zu beachten, aneinander vorbeigingen. Gitarren-Hans, der ja ungemein dürr war, wirkte wie ein Gespenst und die Schwester des Hinterhofkinodirektors war mit den flatternden Haaren und dem wehendem Rock für mich der Inbegriff des Trotzes, dieser „Ich muss das tun“-Haltung, eine Überzeugungstäterin, die dann kläglich im Nichts einer grauen Herbstlandschaft verschwindet. Für die letzte Einstellung wollte ich beide Schauspieler ganz weit weg von der Kamera am Horizont gehen sehen, aber das schafften wir nicht mehr, ich trickste den Abgang mit einem billigen Rückzoom, eine filmästhetisch schäbige Notlösung, trotzdem blieb mir keine Wahl. Beim echten Film hätte man drei Wohnmobile auf den Acker gestellt, damit sich die Schauspieler aufwärmen können, und einen Hubschrauber, der sie zum Horizont fliegt. Das hatten wir alles nicht, wir standen zu dritt verfroren im Nieselregen und dann steckte auch noch das Auto von Gitarren-Hans im Schlamm fest. Die Schwester vom Hinterhofkinoprogrammdirektor musste ans Steuer und wir beiden Männer versuchten, die Karre aus dem Dreck zu schieben. Als wir es geschafft hatten, waren wir von oben bis unten verschlammt und schlotterten wegen der Kälte. Zum Glück war Tina an dem Abend zu Hause geblieben und hatte ordentlich eingeheizt. Trotzdem hüllten wir uns nach dem Dreh verfroren in Decken, tranken Tee und Rotwein. Als ich begann, die Kamera zu putzen, die ein paar Spritzer abbekommen hatte, öffnete Gitarren-Hans den Koffer und spielte seit langem mal wieder auf der akustischen Gitarre. Die aufgelösten Akkorde seines gleichmäßig tröpfelnden Fingerpickings wirkten sofort, das war das Gefühl, zu Hause zu sein und sich wohl zu fühlen. Was er spielte, schien bekannt, klang nach Klischee, aber das machte die Musik nicht banal, sondern es gab ihr sogar eine gewisse Erhabenheit. Als würde diese Musik schon immer durchs Weltall schweben, und Hans hätte sie sich nicht ausgedacht, sondern eingefangen. Die perfekte Musik, um den Film zu vertonen, aber ich hatte kein Tonaufnahmegerät zu Hause und selbst wenn ich eins gehabt hätte, wäre ich nach den anstrengenden Dreharbeiten vermutlich zu faul gewesen, Technik zu suchen oder aufzubauen.
Daran musste ich denken, als ich ein paar Monate später in Berlin saß und wieder fror. Vor mir flimmerten die Filmaufnahmen unseres anstrengenden Drehs. Den Filmtitel „Mein Land im Herbst“ hatte ich inzwischen verworfen, das Werk sollte lieber „Kein Abschied ohne Begegnung“ heißen. Außer dieser Umbenennung war mit dem Material so gut wie nichts passiert. Ich saß an einem 16-mm-6-Teller-Schneidetisch, das ist ein mehrere hundert Kilo schweres mechanisches Monstrum. Oder Wunderwerk. Je nachdem, ob die persönlichen Vorlieben eher den elektronischen und zu den mechanischen Lösungen gelten, wird man einen Schneidetisch unterschiedlich bewerten. Für Menschen wie mich, die sich an den Umlenkrollen mit Perforationszahnrädern erfreuen können, ist ein Schneidetisch eine Sensation. Die ganze Tischplatte ist voll mit diesen Umlenkrollen, symmetrisch angeordnet und in verschiedenen Gruppen zusammengefasst. Der Riesenaufwand dient dazu, den Film so an der Projektionsoptik vorbeizuführen, dass man ihn sowohl schnell, als auch langsam, vorwärts und rückwärts ansehen und direkt auf dem Bild mit einem speziellen weißen Stift Markierungen machen kann oder ihn gleich an der richtigen Stelle auseinanderschneidet, zusammenklebt und so weiter. Außerdem können zwei Rollen mit perforiertem Tonband parallel zum Film eingelegt werden und wenn der Film sich gemeinsam mit den zwei Tonspuren bewegt und all diese vielen Rädchen auf dem Schneidetisch miteinander gekoppelt sind, gleichzeitig starten oder stoppen, dann ist es ein Vergnügen zuzusehen. Doch die Zeit der mechanischen Filmtechnik ist längst vorbei. Sie war damals voll entwickelt, aber am Aussterben. Im Fernsehgeschäft, wo der Produktionsablauf billig und schnell sein sollte, hatte man die Filmschneidetische schon längst durch Videoschnittplätze ersetzt. Der Schneidetisch, an dem ich saß, gehörte einigen Liebhabern, die vom No-Budget-Gedanken beseelt waren und ihre betagte Schnitttechnik für lächerlich niedrige Geldbeträge an andere Liebhaber, Filmemacher und Künstler wie mich vermieteten. Auch das Budget für die Briketts schien knapp zu sein, denn sie waren alle und der Kachelofen kalt. So saß ich mit Strickjacke vor dem Schneidetisch und sortierte das Material. Um die passenden Takes zu einem ersten, groben Entwurf zusammenzuschneiden, brauchte ich etwas mehr als eine Stunde, danach war ich so durchgefroren, dass ich mich zwingen musste, aufzuräumen, also meine restlichen Filmschnipsel zusammenzurollen und mitzunehmen. Das wichtigste war die kleine Spule mit dem geschnittenen Material. Ich brauchte noch die passende Musik, aber Gitarren-Hans war weit weg. Den Schlüssel für den Schnittraum warf ich in den vorgesehenen Briefkasten, dann trat ich auf die winterliche Straße. Draußen war es noch viel kälter und der eklige Geruch von Kohleverbrennung hing in der Luft. Vor meinem geistigen Auge sah ich Gitarren-Hans vor dem grauen Filmhorizont, doch ich selbst lief durch eine lange Straße an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg. Irgendwann nach der soundsovielten Kreuzung sollte die richtige U-Bahnstation kommen. Ich dachte beim Gehen an den letzten Abend im Dorf. Die Schwester des Hinterhofkinoprogrammdirektors hatte mich beim Abschied geküsst. Tina auch, aber nur ganz kurz und dann sagte sie, diesmal könne ja ich mich um die günstige Wohngelegenheit kümmern, bald käme sie nach.
22
Ich hatte mich bei Martin eingenistet, der eine von diesen typischen Zweizimmer-Altbauwohnungen im Hinterhaus bewohnte, wie ich sie in verschiedenen Variationen immer wieder zu Gesicht bekam. Wobei die meisten Berliner, die in so einer schäbigen Bude hausen, keineswegs scharf darauf sind, Freunde zu sich einzuladen, vielmehr ging es oft genug darum, sich dort zu treffen, wo man es besonders cool fand. Wegen unserer langjährigen Freundschaft konnte Martin nicht Nein sagen, als ich einzog, obwohl der Platz ohnehin knapp und die Raumaufteilung mit dem Durchgangszimmer ziemlich ungünstig war. Ich sagte, ich suche mir einen Job und ich suche mir eine Wohnung! Leider passierte monatelang so gut wie nichts. Ich sagte auch noch, dass ich hochmotiviert sei. Abends hatte ich in der Tat viele Ideen, wen ich ansprechen könnte, der eventuell jemanden kennt, der wiederum jemanden anderen kennt, der dann ein kleines Türchen öffnet, durch das ich hineinschlüpfe. Dort hinein, wo man mich brauchen könnte. Tagsüber kümmerte ich mich dann aber doch nicht darum. Immerhin fand ich die No-Budget-Liebhaber und ihren kleinen Laden, so dass ich mich ein bisschen um den Schnitt des 16-mm-Films kümmern konnte. Ab und zu sortierte und ergänzte ich das, was ich für eine Bewerbungsmappe hielt. Wesentlich öfter spielte ich das Spiel mit der Schlange im Labyrinth auf Martins Computer und außerdem zeichnete ich manchmal stundenlang an Trickfilmsequenzen.
Natürlich durchstreifte ich auch die Stadt. In Mitte und Prenzlauer Berg eröffneten viele Bars und in Friedrichshain tobte der Kampf um besetzte Häuser. Die Ruinenromantik im Osten der Stadt hatte etwas Faszinierendes, aber da Martins Wohnung ganz im Westen, in Charlottenburg, lag und das Hinterhofkino und das Büro der No-Budget-Liebhaber in Kreuzberg, verbrachte ich die meiste Zeit dort, wo man von den Umwälzungen gar nicht viel mitbekam. Das störte mich nicht, denn ich wollte auf keinen Fall als Trendnutte gelten. Meine Ausflüge in den Osten waren quasi Exkursionen, damit ich auf dem Laufenden blieb. Die Begründung, dass ich in Berlin sei, weil ich den Anblick von abblätterndem Putz und krummem Straßenpflaster als geiles Lebensgefühl empfinden würde, wies ich stets weit von mir. Der viele Müll, den das große Experiment Sozialismus hinterlassen hatte, machte mich traurig und träge. Vielleicht war das ja auch gar kein Müll, sondern wurde nur von den Rechthabern der Geschichte zu Müll erklärt. Letztendlich waren aber nicht nur viele Exkursionen zur Erforschung der kulturellen Aktivitäten nötig, immer wieder schlich ich auch um neu entstandene Medienzentren oder Niederlassungen der Fernsehsender herum, die sich im Osten eingenistet hatten, um Hinweise darauf zu bekommen, wer mir beim Broterwerb behilflich sein könnte.
Neben meiner Matratze lagen der Stadtplan, die Gelben Seiten und das beliebte Buch über die Kunst des Drehbuchschreibens. Laut Achim gab es dieses Buch sowieso in jedem zweiten Berliner Single-Haushalt, warum also nicht auch bei mir. Leider fand ich niemanden, den ich von meinen Drehbuchschreiberqualitäten hätte überzeugen können. In der Fachabteilung des Arbeitsamtes, wo sie speziell die Künstler und Medienschaffenden betreuten, fragte man mich ganz unverhohlen, wieso ich denn ausgerechnet nach Berlin gekommen sei; damals war Berlin trotz seiner Größe nur ein zweitrangiger Medienstandort, arbeitslose Fernseh-Ossis und Künstler, die mit ihrer Kunst nichts verdienten, drängten in den Arbeitsmarkt. Je weiter westlich, desto besser, meinte der Sachbearbeiter. Ansonsten fiel ihm nichts zu meinen dürftigen Bewerbungsunterlagen ein. Arbeitslosengeld bekam ich sowieso nicht, weil ich beim Lokalfernsehen die meiste Zeit ohne Sozialabgaben als Praktikant gearbeitet hatte. Insofern war die Ausbeute meines Termins beim Arbeitsamt sowohl an hilfreichen Tipps als auch an finanziellen Hilfen unergiebig und demotivierte mich für ein paar Wochen, in denen ich gar nichts tat, was mit Bewerbungen zu tun hatte. Dann ergab sich ein Termin, in den ich viel zu viel Bedeutung hineinphantasiert hatte. Ein älterer Kollege aus dem Lokalfernsehen, eigentlich schon Rentner, der Zeit seines Arbeitslebens große Sachen beim großen Fernsehen in Berlin gemacht hatte, drückte mir zum Abschied ein Empfehlungsschreiben für seinen alten Kumpel die Hand, der irgendwo in den oberen Etagen des Berliner öffentlich-rechtlichen Fernsehens sitzen würde. Allerdings saß der zu weit oben in der Hierarchie, direkt unterhalb des Intendanten und war ein großer Chef von irgendeiner wichtigen Abteilung. Ich rätselte ausführlich darüber, was mein Empfehlungsschreiben wert sein könnte, was ich sonst noch für Bewerbungsunterlagen brauchen könnte und am liebsten hätte ich das Treffen immer weiter vor mir hergeschoben, aber irgendwann hatte ich die Sekretärin des großen Chefs angerufen, die mir ein Datum nannte, das wiederum gut einen Monat nach dem Telefonat lag. Ich wurde zwar empfangen, doch der große Chef wusste auch nicht, was er mit mir anfangen sollte, vielleicht erinnerte er sich gar nicht mehr an den Fernsehrentner, dessen persönliche Empfehlung ich ihm in die Hand drückte und außerdem sei ich ja eigentlich in der falschen Abteilung, um mich vorzustellen und was ich über die öffentlich-rechtlichen Anstalten eh schon wusste, dass sie sich zu fein für Quereinsteiger waren, bestätigte er im Lauf des Gespräches. Letztendlich verabschiedete er mich nach fünfzehn Minuten und er hatte mir keinen anderen konkreten Ansprechpartner genannt, was zweifellos bedeutete, dass ich mich getrost verpissen konnte. Das Stimmungsbarometer blieb daraufhin noch eine Weile im Keller, es schwankte zwischen schlechter und ganz schlechter Laune. Immer wieder blätterte ich die Gelben Seiten durch, wo unter dem Stichwort Film- und Fernsehproduktion eine Menge Einträge zu finden waren, da hätte ich überall eine Bewerbung hinschreiben können. Habe ich aber nicht, mein Einfallsreichtum war schier unerschöpflich, wenn es darum ging, Gründe zu finden, weshalb jede einzelne dieser vielen Firmen speziell für mich unpassend sei, so unpassend, dass eine Bewerbung nicht nur wenig Aussicht auf Erfolg haben würde, sondern sogar eine Anmaßung sei, oder ein Fettnäpfchen, wenn nicht gar ein Skandal.
23
Aber mit einem Mal veränderte sich die Lage schlagartig, denn Ulrich traf in Berlin ein. Der Chef vom Lokalfernsehen hatte ihn nach einem Streit rausgeworfen, unterwegs war ihm das Auto liegen geblieben und mit Rucksack und zwei Plastiktüten, in die er seine Habseligkeiten aus dem Auto gestopft hatte, kam er per Anhalter in Berlin an. Seine Übernachtungsbekanntschaft, die ihn einen Tag vorher erwartet hatte, war nicht mehr erreichbar und so musste er auch noch bei Martin einquartiert werden. Es war nur eine Nacht, dann brach er schon wieder auf, um die Verschrottung seines Autos, das irgendwo in den neuen Bundesländern auf einem Autobahnrastplatz stand, zu organisieren. Und ich sollte gefälligst sofort die Wohnung klar machen, sagte er mir beim Abschied. Denn zwei Tage vor Ulrichs Ankunft hatte ich Sabine und ihre drei Monate alte Tochter auf einen Kaffee besucht. Ihr war gerade eine gute Wohnung in einer der abgefucktesten Gegenden der Stadt angeboten worden. Sie hatte abgelehnt, denn nach kurzem Abwägen bevorzugte sie, mit dem Kind lieber in einer Anliegerwohnung in der Villa ihrer Eltern einzuziehen, irgendwo dort, wo nur wohlhabende Menschen wohnen. Das Wohl des Kindes war ihr vermutlich wichtiger als die soziale Tarnung in einem Proletenstadtteil. Mir fiel es wie Schuppen von den Augen, dass Sabines Unnahbarkeit durch ihre großbürgerliche Herkunft zu erklären sei, die sie nur zögernd preisgab. Inzwischen hatte ich auch erfahren, dass der Vater des Kindes aus diplomatischen Kreisen stammte, aber ich konnte es mir nicht merken, zu welchem der vielen afrikanischen Staaten er gehörte. Die Wohnung in Neukölln, die sie abgelehnt hatte und nun mir anbot, schien mir zunächst zu groß und zu teuer, ich wollte keinen Mietvertrag am Hals haben, solange kein Job in Aussicht war. Aber als Ulrich auftauchte, der davon redete, dass auch noch ein Design-Kollege nachkommen könnte, überzeugte er mich, dass wir sofort zu dritt diese Wohnung nehmen sollten, um uns dann kompromisslos auf die Jobsuche zu konzentrieren. So kam es, dass Martin nach einem quälend langen halben Jahr endlich wieder seine Wohnung für sich allein hatte.
Ich brachte meine Matratze, die Transportkisten und die Schallplattensammlung mit einem gemieteten Kleintransporter in die neue Wohnung und noch bevor ich mir Regale und ein Bett besorgen konnte, zwang mich Ulrich, gemeinsam mit ihm loszuziehen, zu den vielen Film- und Fernsehproduktionsfirmen, deren Namen ich immer nur in den Gelben Seiten angeglotzt hatte. Immer noch fand ich bei jeder einzelnen meine Gründe, weshalb ein Erfolg unwahrscheinlich oder aussichtlos sei, doch Ulrich ließ keine Ausreden gelten, wir fuhren mit der U-Bahn durch die Stadt und gingen leibhaftig zu jeder der vielen Adressen, eine nach der anderen. Hallo, wir sind neu in Berlin, er ist Kameramann, ich arbeite als Cutter, könnt ihr uns brauchen? Schon nach ein paar Tagen gab es die ersten heißen Spuren. Ulrich knüpfte verschiedene Kontakte, bei denen er abwechselnd Tagelöhnerdienste ableistete, was bei Cuttern weit verbreitet war. Ich fing einige Wochen nach dem Umzug tatsächlich in einer kleinen Videofirma an.
Mein Privatleben wurde nun wie mit einem Schalter ausgeknipst, ein dreiviertel Jahr lang war ich ständig unterwegs. Wir drehten billige Kurzbeiträge, Feuilletonistisches aus den neuen Bundesländern, die irgendwo im Privatfernsehen gesendet wurden. Damit sich das bei unserem niedrigen Minutenpreis für die fertiggestellten Reportagen lohnte, musste jeder Beitrag an einem, oder bestenfalls an anderthalb Tagen komplett abgedreht werden. Früh um sieben in Berlin losfahren, um zehn kamen wir dann in Rostock, Halle, Cottbus oder sonst einer medial unterversorgten Stadt an und dann hielt ich drauf, bis alles im Kasten war. Abends, zu unbestimmter Zeit, kamen wir zurück, steckten die Akkus ins Ladegerät und am nächsten Morgen fuhren wir wieder los. Ab und zu drehte auch der Chef, ein lässiger Selfmademan, der angeblich als Kameramann im Balkankrieg zu Geld gekommen war. Ich war der allzeit verfügbare Kameramann für seine sechs bis acht Reporterinnen, alles attraktive Frauen, die mit einer eher theoretischen Ausbildung direkt von der Uni kamen und die sich dann für ein bescheidenes Pauschalhonorar um alles kümmern mussten: Thema finden, Kontaktpersonen recherchieren, Drehtermine ausmachen und letztendlich mit mir und einem Praktikanten hinfahren, filmen, interviewen, zurückfahren, schneiden, texten.
Den Schnitt machten sie mit dem Chef oder einem Tagelöhner, aber da war ich ja schon wieder auf der nächsten Tour, filmte Ostalgietreffen, Pantoffelwerkstätten, Erfindermessen, Puppendoktoren, Wendeverlierer und alles, was den gelangweilten Fernsehzuschauer auf harmlose Weise unterhalten könnte. Beim Lokalfernsehen hatte ich das auch gemacht, aber nun waren die Auftraggeber pingeliger, die Reporterinnen ambitionierter und die Drehorte lagen teilweise Hunderte von Kilometern entfernt. Unzählige Staus, die sich an den Baustellen des Verkehrsprojektes „Deutsche Einheit“ bildeten, mussten wir überwinden, um dorthin zu gelangen, wo wir das Wesen der geschundenen Ossi-Seele zu ergründen suchten. Solange wir uns als Team gut verstanden, waren unsere Touren spannende Ausflüge mit Kamera, aber nach einem halben Jahr schwirrte mir der Kopf und wenn man mich fragte, wo ich zwei Wochen zuvor gewesen war, dann fiel es mir schon nicht mehr ein, ein klarer Fall von Reizüberflutung. Aber es fragte mich niemand, da ich mich meistens nur mit den Leuten unterhielt, die bei der Arbeit mit mir im Auto saßen.
Ab und zu traf ich mich zum Bier trinken und lästern mit Achim. Mein Mitbewohner Ulrich war inzwischen auch ganz gut im Geschäft. Bei ihm häuften sich die Spätschichten, denn er war ein richtiger Nachtmensch. Auch Wochenendschichten übernahm er gern, da sie besser bezahlt wurden, was dazu führte, dass wir uns in der Wohnung oft Tagelang überhaupt nicht sahen. Dann zog Henry ein, von dem ich später erfuhr, dass er gar nicht Henry hieß, sondern eigentlich Herbert, aber das war ihm zu altmodisch. Mit großem Hallo begrüßte er mich, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. Er behauptete, Ulrich hätte viel von mir erzählt und meine Filme kannte er angeblich auch. Er musste also in einer meiner Filmvorführungen gewesen sein. Henry kam am gleichen Tag, an dem auch Achim plötzlich mit der Theaterstückeschreiberin vor der Tür stand. Seit Wochen oder Monaten war kein Besuch bei uns vorbeigekommen und dann plötzlich so viele. Henry saß, als ich nach Hause kam, in dem kleinen Zimmer, das Ulrich und ich nur für den Wäscheständer benutzten, auf einem großen aufblasbaren Ball an einem ganz kleinen Tisch, vermutlich ein Klapptisch und auf dem kleinen Tisch stand einer von diesen kleinen Macs mit dem 7-Zoll-Bildschirm. Neben dem Computer lagen ein kleines Notizheft und ein sauber angespitzter Bleistift. Er sei heute Nachmittag eingezogen, Ulrich hätte ihn hereingelassen, sagte er. Alles sei prima und er schon fertig mit dem Einräumen, da er nichts besitzen würde außer der Matratze und einem Koffer mit ein paar Klamotten. Beim Reden deutete er auf die Dinge, von denen er gerade sprach und ansonsten hätte er ja nur den „Kleinen“, wobei er den Mac tätschelte. Im Kühlschrank sei Bier und er habe Chili con Carne gekocht. Als er das sagte, fiel mir auf, dass ich mich beim Betreten der Wohnung über den Essensgeruch gewundert hatte. Unser größter Topf war bis oben voll, damit es sich lohnen würde und Chili con Carne könne man ja drei Tage lang problemlos aufwärmen. Das war gut, denn ich hatte Hunger.
Kaum saßen wir in der Küche, die Bierflaschen gerade geöffnet, klingelte es und Achim mit der Theaterstückeschreiberin, die ich ja noch nie gesehen hatte, standen vor der Tür. Kein Wunder, erklärte Achim, sie sei gerade erst nach Berlin gekommen, irgendeinen Nachwuchstheaterschreibepreis hätte sie schon eingeheimst und jetzt würde sie ganz in der Nähe wohnen, weil er, Achim, ihr eine günstige Wohnung besorgt hätte und da Theater eine dem Untergang geweihte Kunst sei, wolle er sie mit mir bekanntmachen. In seiner überheblichen Art fügte er hinzu, dass 99 Prozent der Theater zurecht untergehen würden, weil sie quasi mit Absicht und vollsubventioniert von unfähigen Theaterleuten an die Wand gefahren würden, aber es gäbe ja noch diese eine Prozent von guten Leuten, von Theatermachern, die tatsächlich auch mal eine originelle Idee hätten und da würde die Theaterstückeschreiberin, obwohl sie noch blutjung sei, dazugehören. Jetzt stellte sich für Achim allerdings die Frage, ob er das zu lassen dürfe, ob es sich lohnen würde, der Theaterstückeschreiberin dabei zu helfen, sich gegen die 99 Prozent der unfähigen, aber in hochbezahlten Intendanten- Regie- und Dramaturgenpöstchen verschanzten Theaterkunstverderber aufzulehnen, oder ob es nicht sinnvoller sei, sie von ihrem Theaterstückschreibewillen zu exorzieren und der Filmkunst zuzuführen.
Ich will keine Filme machen, das machen doch alle, sagte die Theaterstückeschreiberin. Jetzt bemerkte ich, dass sie, wenn sie sich erregte, in ein deutliches Sächseln verfiel. Filmkultur ist Leitkultur, proklamierte Achim und Henry fügte hinzu: im Guten wie im Schlechten. Denn es sei doch der Film einerseits vom Mainstreamwillen, vom Blockbusterwahn, von der selbstgewählten Einschaltquotenhörigkeit völlig korrumpiert, aber andererseits sei der Film, also genaugenommen der Kinofilm, auch das Medium, das ernstgenommen werde, in dem die Weltkultur stattfinde. Der Film sei DIE Kunstform des 20 Jahrhunderts. Das war Wasser auf Achims Mühlen, da zog er sogleich über die Theatermacher her, die ja angeblich immer noch nicht kapiert hätten, dass sie all das, was der Film sowieso viel besser könne, nicht mehr zu tun bräuchten, aber unbeirrt würden sie in zwangsneurotischer Symbiose mit ihrem vergreisten Bildungsbürgerspießerpublikum an dem festhalten, was nicht mehr zu retten sei. Und Henry: Die Filmfestivaltouristen von heute sind die Bildungsbürgerspießer von morgen. Ich stellte unterdessen fest, dass das Chili con Carne wirklich gut schmeckte, wollte auch mal was sagen: Die Avantgarde kann nichts dafür, wenn sie irgendwann bei den Spießern ankommt. Dafür dürfen wir sie nicht verachten, ganz im Gegenteil. Wenn ihr niemand folgt, dann verdient sie ihren Namen gar nicht. Das ist banal, entgegnete die Theaterstückeschreiberin, obwohl ich damit für sie Partei ergreifen wollte und Henry musste mir auch noch widersprechen: Die vermeintlichen Spießer, die der Avantgarde folgen, sind keine Spießer, Spießer sind die, die zurückbleiben. Achim wiederum: Inzwischen sind doch die, die sich unreflektiert an den neuesten technischen Errungenschaften aufgeilen, die wahren Reaktionäre, das sähe man an dem allgegenwärtigen Videodreck. Damit meinte er wohl pauschal das Privatfernsehen, oder etwa Videokünstler? Achim hatte, so kannte ich ihn, das Bedürfnis, immer noch etwas deftiger zu schimpfen als die anderen. Henry hingegen war der kritische Kulturfeingeist, ein Designer eben, der überall auf der Suche nach der feinen Trennlinie zwischen dem Geschmacklosen/Schlechten, und dem Edlen/Guten war.
Die hübsche Theaterstückeschreiberin, der wir alle drei imponieren wollten, saß zwischen uns und vermied es, irgendjemandem zuzustimmen. Auch nicht mir, obwohl ich versuchte, mit meiner Argumentation weit und poetisch auszuholen, was mir in der hitzigen Diskussion nur gelang, weil Achim sich gerade Chili con Carne auf den Teller schaufelte, und Henry, dadurch abgelenkt, kurze Erläuterungen zur Zubereitung gab. Das kollektive Menschheitsbewusstsein werde sich durch die geistige Entwicklung verändern. Und vermutlich sei die Veränderungsgeschwindigkeit relativ konstant, da jeder einzelne Mensch seine Zeit brauche, um sich an neue Lebensbedingungen anzupassen, und gleichzeitig finde der Austausch der Menschen durch das Wegsterben der Alten und das Nachwachsen der Jungen ebenfalls in einer konstanten, oder sogar sinkenden, Geschwindigkeit statt. Die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung sei allerdings keineswegs konstant, sie habe sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten drastisch beschleunigt. So wie beim Überschallknall, der dann auftrete, wenn die Geschwindigkeit der Schallquelle höher sei als die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalles, gebe es auch bei der Menschheitsbewusstseinsentwicklungsgeschwindigkeit einen kritischen Wert, der dadurch definiert werde, dass die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts die Entwicklungsgeschwindigkeit der mentalen Auffassungsgabe überhole. Dann befänden wir uns im kritischen mentalen Überschallbereich, den man vielleicht als „Entwicklungshypergeschwindigkeit“ bezeichnen könnte.
Das sagt mein Opa auch, kommentierte Henry und Achim lobte das Chili con Carne. Wo ist denn der Flaschenöffner? fragte die Theaterstückeschreiberin, die tatsächlich schon ihr erstes Bier leer hatte. Dann kam auch noch Ulrich nach Hause, der sich ebenfalls auf das Bier und das Chili con Carne stürzte und dabei ein paar Sätze mit Henry austauschte, ob er in dem kleinen Zimmer zurechtkommen würde. Während das restliche Gespräch begann, sich um WG- und Lebensumstände zu drehen, schaute Ulrich die Theaterstückeschreiberin immer wieder verwirrt an, bis er plötzlich mit der völlig unvermittelten Frage herausplatzte, ob sie denn gerade im Rahmen eines Stipendiums an einem Theaterstück über eine Doppelkopf spielende Männerrunde schreiben würde, und die Doppelkopfspieler seien eigentlich eine linke Spaß-Guerilla, die Aktionen gegen die Treuhandanstalt plane. Diese Frage ließ uns alle aufhorchen, erst recht, als die Theaterstückeschreiberin sie bejahte. Da war Ulrich plötzlich aus dem Häuschen, denn das sei ja der Wahnsinn, vor einer Stunde habe er noch am Schnittplatz gesessen, denn er schneide gerade einen längeren Bericht, eine umfangreiche Reportage, über Künstler, die sich mit den Verfehlungen und Missständen der Wiedervereinigung auseinandersetzten. Er sei leider nur der Cutter und er habe nicht einmal alles geschnitten, aber heute, gerade heute, sei es darum gegangen, ein Interview mit der jungen, gerade mit einem Preis und einem Stipendium geehrten Theaterstückeschreiberin zusammenzukürzen. Deshalb habe er sie gerade eben auf dem Monitor gesehen und jetzt säße sie in seiner Küche, das sei ein Zufall, der ihn völlig verwirre, erklärte Ulrich und in der Tat war er sichtlich durcheinander.
Er erzählte begeistert, dass der Reporter gesagt habe, die Schriftstellerin sei noch jung und auch nicht so wichtig, da dürften wir auf keinen Fall von ihr mehr Sekunden drin haben als von dem altehrwürdigen DDR-Schriftstellerverbandsehrenvorsitzenden, der an ach so vielen runden Tischen gesessen habe, dessen Interview aber leider stinklangweilig und unambitioniert gewesen sei, weil, so vermutete der Reporter, er Hunger gehabt habe, aber der quasi verbeamtete öffentlich-rechtliche Kameramann habe nicht länger warten wollen, wegen der Überstunden, und da habe man das Interview mit dem DDR-Schriftstellerverbandsehrenvorsitzenden überstürzt vor dem Bankett machen müssen, obwohl es danach bestimmt viel besser geworden wäre. Deshalb hätten sie am Schneidetisch aus dem tollen Interview mit der jungen Theaterstückeschreiberin schnell eines der vielen guten Statements herausgeholt und sich dann lange damit gequält, das verschnarchte Genuschel des DDR-Schriftstellerverbandsehrenvorsitzenden durch eine geschickte Montage interessant wirken zu lassen. Die Reportage wäre besser und stringenter, wenn man den DDR-Schriftstellerverbandsehrenvorsitzenden komplett rausgelassen hätte, aber, so die Logik der Programmmacher und Redakteure, viele Leute würden es sich dann gar nicht anschauen, sie bräuchten immer einen bekannten Namen. Wenn da nur No-Names vorkämen, auch wenn sie tolle Nachwuchspersönlichkeiten seien, dann schaue sich das der Normalzuschauer NICHT an, dann wisse man als Redakteur gar nicht, wie man den Zuschauern im Programmheft und im Infotext den Beitrag schmackhaft machen solle. Allerdings, und dann machte er eine Pause, um die Theaterstückeschreiberin groß anzuschauen und uns schaute er auch groß an, erst dann rückte er mit seiner Frage raus: Ob sie denn wirklich Marianne Wurststock heiße? Oder ob das ein Künstlername sei?
Natürlich heiße ich so, antwortete sie und dann ging die Diskussion erst so richtig los. Die Designer, Ulrich und Henry, waren davon überzeugt, dass dieser Name auf keinen Fall beibehalten werden dürfe, es sei denn, sie wolle Heimatromane oder Kochbücher schreiben, ich wiederum pochte immer wieder auf die Originalität und Bedeutungsschwere, die diesem Name innewohne, aber Achim versteifte sich darauf, Authentizität als moralische Notwendigkeit zu definieren. Schriftsteller seien in einer symbiotischen Beziehung mit der Wahrheit verstrickt, da sei die Abkehr vom eigenen Namen ein eklatanter Sündenfall. Nur die Groschenheftschreiberlinge verwendeten Pseudonyme. Henry ging gar nicht auf Achims Moralappell ein, dazu sei, seiner Meinung nach, die Lage zu ernst. Sie müsse schnell handeln, forderte er, denn das Einzige, was noch schlimmer als ein untauglicher „Produktname“ sei, sei ein Wechsel des Produktnamens, wenn sich dieser bereits im Bewusstsein der Kunden verfestigt habe. Ulrich bot sogar an, bei einer sofortigen Umbenennung der Theaterstückeschreiberin könne er dafür sorgen, dass sie in der wichtigen Fernsehreportage, die gerade im Entstehen sei, bereits mit dem neuen Namen genannt werde. Dagegen lief Achim Sturm, ihn bringe ja schon allein die Wortwahl zur Weißglut, „Produktname“ und „Kundenbewusstsein“, es gehe doch hier um Marianne und ihre Schriftstellerei, was eine persönliche, intellektuelle und künstlerische Position sei und kein Schokoriegel. Dann holte er zu einer weitgespannten Anklage aus, die darin gipfelte, dass Designer und die mit ihnen verbündeten Werbefuzzis die Steigbügelhalter des Kapitalismus seien und sowieso nur die Absicht hätten, die Kultur und Kunst entweder für ihre niederen Ziele zu instrumentalisieren oder, sofern ihnen das nicht gelänge, in den Schmutz zu treten. Seine Argumentation war so überzogen pathetisch, dass wir uns alle prächtig amüsierten und unter großer Erheiterung nicht nur die nächste Runde Bierflaschen geöffnet wurde, sondern auch eine Flasche Wodka auf den Tisch kam. Ich forderte Achim auf, die Diskussion damit zu beenden, dass er einen Toast auf die echte und einzige Marianne Wurststock aussprechen solle, was er mit der nötigen Ernsthaftigkeit tat. Ins Bett gingen wir erst, als das Bier und der Wodka alle waren.
24
Auch wenn Marianne Achims Vorschlag, dass sie zum Film konvertieren solle, ablehnte, half sie mir bei einigen Projekten. Zum Glück, denn seit ich in Berlin lebte, waren meine künstlerischen Aktivitäten weitgehend eingeschlafen. Am Anfang deprimiert und motivationslos, dann überarbeitet. Doch inzwischen steckte die kleine Firma, die mich Tag für Tag auf Trab gehalten hatte, offensichtlich in Zahlungsschwierigkeiten. Das Geld wurde Monat für Monat mit größer werdender Verspätung auf mein Konto überwiesen und den Chef sah man kaum noch. Die Aufträge gerieten ins Stocken, was mir sehr gelegen kam, den nun hatte ich auch unter der Woche manchmal einen Tag frei oder nur einen kurzen Arbeitstag. Während ich anfing, mir wieder Gedanken zu machen, wie ich meine begonnenen Filme zu Ende bekäme und was ich danach versuchen könnte, schauten sich meine Reporter-Kolleginnen nach anderen Jobs um und dadurch entstanden Beziehungen, über die auch ich ab und zu bei neuen Auftraggebern einen Einsatz als Kameratagelöhner bekam. Es sah also schon viel besser aus als bei meiner Ankunft in Berlin, ich hatte einen Fuß drin im Geschäft. Nachdem mich Achim mit Marianne bekannt gemacht hatte, konnte es endlich wieder damit losgehen, dass ich Geld verdiente UND eigene Filme machte.
Die 16-mm-Aufnahmen, die ich unter großen Mühen im Dezember auf dem Land inszeniert hatte, waren jetzt, über ein Jahr später, immer noch nicht fertig vertont. Marianne bestärkte mich darin, einen poetischen Text zu schreiben, den sie mit ihrer weichen Stimme völlig dialektfrei einsprach. Der Film machte dort weiter, wo meine Liveperformance mit den vergessenen Dingen aufgehört hatte. Einen Knalleffekt gab es wieder nicht, aber ich fand die Atmosphäre dicht genug, den Schnitt präzise, den Text perfekt. Marianne hatte ein paar Änderungen daran vorgenommen, gegen die ich mich zunächst sträubte, aber rückblickend musste ich neidisch feststellen, dass sie ganz schnell und ganz genau bemerkt hatte, wo meine Formulierungen zu lasch und zu beliebig waren.
Bereits vorher hatte Tina mir per Post eine Audiokassette mit Aufnahmen von ihrer Band geschickt. Die Band habe sich aufgelöst, aber trotzdem käme sie selbst erst einmal nicht nach Berlin, es sei, wie sie sich ausdrückte, für sie noch etwas zu erledigen. Bestimmt eine neue Affäre, sagte ich mir, denn wenn Tina sich in Schweigen hüllte, steckte meist eine Liebschaft hinter ihrer Geheimnistuerei. Auf der Rückseite der Kassette gab es ein wunderbares Gezupfe von Hans auf der akustischen Gitarre, unterlegt mit einem minimalistischen Bass und einem dezenten Gezirpe von Tinas Synthesizer. Das passte hervorragend zum Film. Die Gitarre zur spröden Schlechtwetterlandschaft und das Gezirpe zu den Kratzern, die ich in das Material geritzt hatte. Die Besonderheit des Filmes bestand inzwischen darin, dass ich in wochenlanger Kleinarbeit in jedes einzelne Bild mit einer Nadel tiefe Kratzer eingefügt hatte. Einen Strahlenkranz um den Kopf der Hinterhofkinoprogrammdirektorenschwester oder zuckende Blitze in die Hände von Gitarren-Hans. Das sah gut aus, konnte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in dem Film nicht viel passierte. Deshalb brauchte ich zusätzlich den Text, der mir aber erst einfiel, nachdem ich die Theaterstückeschreiberin kennengelernt hatte.
Sie kam mit in den Schnittraum der No-Budget-Liebhaber, wo wir die Audiokassetten mit ihrer Stimme und mit der Musik von Tinas Band auf ein perforiertes Magnetband überspielten, wozu ein mannsgroßes Perfobandaufnahme- und Abspielgerät, ein sogenannter Perfoläufer, nötig war. Das perforierte Magnetband ließ sich in den Schneidetisch mit den vielen Rollen und Zahnrädern einlegen und entweder passte man den Ton an das Bild oder das Bild an den Ton an. Jeweils mit Schere und Klebelade. Die Länge des Musikstückes stimmte, da gab es nicht viel zu tun, aber der Text war kürzer als der Film. Damit die Textpassagen an die richtige Stelle gelangten, musste Stille eingefügt werden, wofür es ein spezielles blaues Plastikband gab, das allerdings gerade nicht zu finden war. Einer von den No-Budget-Liebhabern, der im Hinterzimmer an einem tschechischen Projektor herumschraubte, rief mir zu, das Blauband sei im Regal. Das war ein sehr vager Tipp, denn das Regal nahm die gesamte Längswand des schmalen Raumes von oben bis unten ein, vollgestapelt mit nützlichen und nutzlosen Geräten, die eventuell irgendwann einmal zum Filmemachen gedient hatten oder dienen könnten. Marianne stieg auf die Leiter und suchte ganz oben, wo sie eine Filmklappe fand, mit der sie ein paar Mal freudig klappte: die erste, die zweite und die dritte. Ich durchsuchte mehrere Koffer, in denen Baustrahler und Kabeltrommeln verpackt waren, Ersatzmagazine für eine 35-mm-Kamera, Stative in den unterschiedlichsten Qualitäten für Kameras und Lampen, jede Menge Kartons mit Ersatzteilen für optische Geräte, noch mehr Kabeltrommeln und Mehrfachsteckdosen, alles Mögliche, nur kein Blauband. In einer unauffälligen Reisetasche entdeckte Marianne eine aufblasbare Fickgummipuppe, was uns amüsierte. Unser Gelächter sorgte dafür, dass der No-Budget-Liebhaber aus dem Nebenzimmer kam, eine Rolle Blauband in der Hand, und uns erklärte, dass Gummipuppen für Stunts, vor allem für Stürze von Gebäuden, die einfachste Lösung seien. Man müsse sie natürlich entsprechend anziehen, aber das müsse man ja bei allen Stunts. Er legte das Blauband auf den Schneidetisch und verschwand wieder. Als Marianne von der Leiter stieg, erklärte ich ihr, dass man statt des Blaubandes genauso gut unbespieltes Magnetband nehmen könne, wovon genügend neben dem Schneidetisch herumliege, aber mit dem blauen Band sähe das Hindurchschlängeln der geschnittenen Audiospur durch die Zahnräder und Umlenkrollen viel besser aus als bei eintönig braunen Magnetband. Außerdem hatte das den Vorteil, dass sich quasi jeder Texteinsatz vorher ankündigte, denn ähnlich wie die Schlange in dem Computerspiel, das ich so gerne mit Martin spielte, schob sich die Grenze zwischen dem stummen blauen Band und dem bespielten braunen Magnetband von der Spule links kommend durch die Rollen, und wenn das Magnetband in der Mitte an dem großen Tonkopf anlangte, ertönte die Stimme Mariannes, die wir durch Verkürzen oder Verlängern des Blaubandes an die richtige Position brachten. Das schneiden und kleben machte Spaß und die Zeit verging dabei wie im Flug.
Marianne hatte gerade ihre zweite Flasche Bier genommen und saß auf dem Fensterbrett des offenen Fensters, um zu rauchen. Ich wechselte die Musikspur mit der Geräuschspur und versuchte ihr zu erklären, dass ich noch beliebig viele weitere Spuren hinzufügen, aber leider immer nur zwei gleichzeitig am Schneidetisch würde hören können, weil es ja ein 6-Teller-Tisch sei, was bedeute, dass eine Bild- und zwei Tonspuren darauf Plätz hätten. Man müsse höllisch drauf achten, dass alle Spuren auch wirklich synchron seien, sagte ich mit dem Unterton des Bescheidwissenden und Marianne riss die Augen auf, ein schriller Schrei erstickte ihr im Hals, den Arm warf sie vors Gesicht. Dann kapierte ich, dass es nicht die Angst vor einer asynchronen Tonspur war, die ihr den Schock eingejagt hatte, sondern das Regal hinter mir. Schockiert drehte ich mich um. In den Augenwinkeln hatte ich die Gefahr bemerkt und was ich sah, versetzte mich für den Bruchteil einer Sekunde in Todesangst, denn das riesige Regal, das ja bis zu Decke reichte, kippte in seiner ganzen Breite auf mich zu wie eine sich überschlagende Welle in der Brandung. Die schweren Kisten mit den Baustrahlern sah ich direkt auf mich zukommen, ich riss die Hände hoch, doch dann änderten die Kisten ihren Kurs, es fing an zu scheppern und zu klirren, alles fiel auf den Boden und die Lawine der No-Budget-Filmgeräteverleihkisten rutsche mir bis vor die Füße, aber nicht weiter.
Marianne und ich atmeten erleichtert aus. Die Schienen, an denen die Regalböden befestigt waren, hingen schief an der Wand. Sie hatten sich verbogen, aber nur im oberen Bereich gelöst. Durch die Schieflage waren die Kisten aus dem Regal herausgerutscht, zu guter Letzt sogar die Tasche mit der Fickpuppe. Dadurch wurden die Regalschienen entlastet und sie verbogen sich nicht weiter. Wenn das Regal steif gewesen und umgekippt wäre, hätte es mich bestimmt erwischt, da der Raum höher als breit war. Nun kam der No-Budget-Liebhaber aus dem Hinterzimmer angerannt und sagte, dass er schon immer befürchtet habe, die Dübel könnten zu schwach für das vereinte Gewicht des umfangreichen Technikbestandes sein. Wenn das vorhin passiert wäre, dann lägen wir jetzt unter dem Haufen, beschwerte sich Marianne und nahm einen nervösen Schluck aus der Bierflasche. Hoffentlich ist die Bolex nicht im Eimer, erwiderte der No-Budget-Liebhaber, die Arri sei ihnen ja erst neulich geklaut worden und dann hätten sie gar keine funktionierende 16 mm-Kamera mehr. Er wühlte wirr im Technikhaufen herum. Schließlich fragte er, ob wir mit dem Filmschnitt fertig seien, er müsse erst mal aufräumen und den Schreck verdauen. Er solle sich nicht grämen, meinte Marianne, der Fickpuppe sei bestimmt nichts passiert, die sei ja für Stürze vorgesehen. Ich rollte unterdessen meine Tonspurmagnetbänder und den Rohschnitt des Films zusammen, steckte alles in die Tasche und wir gingen, ohne die vereinbarten 20 D-Mark Schnittplatzmiete zu bezahlen.
Für Perfoband, Blauband und die Überspielung von Kassette auf das Perfoband seien auch jeweils soundsoviel Pfennige pro Meter zu berechnen, erklärte ich, als wir die Straße entlangliefen. Marianne war entsetzt. Ob ich denn auch noch dafür bezahlen wolle, dass man uns fast umgebracht habe? Das sei doch keine Absicht gewesen, sondern nur Fahrlässigkeit, die daraus resultiere, dass sich die armen No-Budget-Liebhaber das alles vom Mund absparten und sich leider keine größeren Dübel hätten leisten können, weil sie stattdessen lieber eine Rolle Blauband kauften. Das seien Technik-Onanisten, behauptete Marianne, sie hätte das durch die Entdeckung der Puppe durchschaut und ich solle auch aufpassen, dass ich nicht zu sehr auf all die Zahnräder und Umlenkrollen schaue, sondern auf die Mattscheibe. Den Zuschauer interessiere es nicht, ob dieses komische blaue Band wie eine Schlange im Computerspiel über den Schneidetisch gekrochen sei. Aber wenn ich keine Beziehung zu der Technik habe, mit der ich arbeiten muss, dann macht mir das keinen Spaß. Willst du einen guten Film machen oder willst du Spaß haben? Beides, sagte ich und schüttelte wirr meine Arme. Das ist ein hoher Anspruch. Mal sehen, ob dir das gelingt. Dann nahm Marianne einen großen Schluck und leerte damit auch ihre zweite Bierflasche, die sie an den Straßenrand stellte. Jetzt können wir etwas Trinken gehen, sagte sie, denn wir standen sowieso gerade vor einer von Achims vielen Lieblingskneipen.
25
Also erst mal einen Whisky auf den Schreck. Dann nutzten wir den Münzfernsprecher, um Achim dazu aufzufordern, zu uns zu kommen. Wir brauchten jemanden, dem wir die unglaubliche Geschichte mit dem Regal erzählen konnten. Achim freute sich über unseren Anruf, er müsse sowieso etwas Wichtiges mit Marianne besprechen, aber vorher habe er noch einen dringenden Termin, der nicht lange dauere. Leider im falschen Stadtteil, deshalb sollten wir schon mal unbeschwert ein Bier trinken. Er käme so schnell es ginge und das war letztendlich eineinhalb Stunden später.
Wir unterhielten uns unterdessen zunächst über das Mariannes Projekt, dem Stück über die Doppelkopf spielende Spaß-Guerilla, mit der sie dank Achims Hilfe ganz gut voran käme. Achim quatsche ihr nicht in ihr Projekt rein, wie sie es zunächst befürchtet hatte, sondern er kümmere sich nur um die Rahmenbedingungen. Wenn es ums Kreative ging, ließ er sie in Ruhe und würde ausgiebig an seinem eigenen Drehbuch herumphantasieren. Achim schreibt ein Drehbuch, fragte ich ungläubig und Marianne wies darauf hin, dass sie das Verb Herumphantasieren benutzt habe, wenn es ums schreiben ginge, gäbe es verschiedene Problem. Ich kannte Achim als jemanden, der begeistert mitmachte, aber selbst keine Initiative ergriff. Mangel an Selbstorganisation oder Probleme mit den eigenen Ansprüchen, vielleicht auch einer, der die Aufgaben zu lang vor sich herschiebt. Deshalb hatte Achim chronische Probleme mit dem Studieren und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, ob er noch für irgendein Fach immatrikuliert war.
Marianne, die Achim erst seit einigen Monaten kannte, meinte, ihr gegenüber habe er sich dahingehend geäußert, dass es ihn nicht interessiere, zu studieren, da ihm der akademische Wissenserwerb zu schwerfällig und unzeitgemäß erscheine, er sei an der Praxis orientiert. Um Kulturmanagement erfolgreich zu betreiben, müsse man keinen Doktor über das Verhältnis von Adorno zur Naturwissenschaft schreiben, habe er gesagt, weil der Agentur-Chef, für den Achim regelmäßig an Werbekampagnen arbeitete, tatsächlich über Adorno promoviert habe. Deshalb wisse Achim, dass es durchaus schädlich sei, wenn eine derartige geisteswissenschaftliche Überqualifikation bestehe. So berichtete Marianne über Achim. Nach meinem Informationsstand bestand Achims Mitarbeit an Werbekampagnen darin, dass er Plakatierer war. Weil er keinen Führerschein hatte, sogar nur Hilfsplakatierer. Man könnte auch sagen, Plakatierungsassistent: abends zu zweit mit dem Leimtopf und einem Stapel Plakaten im Kleinbus durch die Stadt, wobei der Fahrer grundsätzlich weniger mit dem Leim zu hantieren hat, damit das Auto sauber bleibt. Angeblich würde man ganz gut verdienen, wenn man schnell genug plakatiere, wenn man gut im Blick habe, wo ein frischer Bauzaun stehe, der groß genug für 50 Plakate nebeneinander sei oder ab und zu die Plakate der anderen Agentur überklebe. In der Tat könne eine intensive Beschäftigung mit Adorno die Klebegeschwindigkeit negativ beeinflussen, gab ich zu bedenken. Achim rede allerdings nicht nur von seinem Drehbuch, sondern auch von der Drehbuchförderung, die er beantragen wolle, erklärte Marianne. Dazu konnte ich nichts sagen, weil ich nichts darüber wusste, aber ich formulierte die Vermutung, dass Achim nur sehr langsam mit dem Drehbuch vorankommen würde. Das sei wohl zutreffend und das Hauptproblem, räumte Marianne ein. Es gäbe viele Fragmente der Handlung, doch die Anfangsszene bereite ihm die allergrößten Schwierigkeiten, immer wieder komme Achim zu ihr und sage, er hätte einen neuen Anfang und solange er sich nicht entscheide, wie es losgeht, könne er nicht mit dem Schreiben beginnen, geschweige denn fertig werden und so stünde er sich selbst im Weg. Vielleicht sollten wir ihm unter die Arme greifen, als Dreierteam, schlug sie vor, und da kam er gerade herein, entschuldigte sich für die Verspätung, die wegen einer unnötigen U-Bahnbaustelle entstanden sei, aber er hätte gute Nachrichten, denn Marianne könne schon am Wochenende bei einem mit Achim befreundeten Akkordeonlehrer einziehen, eine wunderbare Wohnung im mittelwestlichen Westen, womit Achim den großbürgerlichen Norden von Wilmersdorf meinte.
Marianne schaute allerdings fast so verschreckt wie in dem Moment, als das Regal auf sie niederstürzte, denn sie wusste überhaupt noch nichts von ihrem Umzug. Das könne sie ja auch gar nicht, da sich die Ereignisse gerade überstürzten, aber er, Achim, habe alles im Griff. Die Besitzerin der Wohnung, in der Marianne untergebracht sei, käme vorzeitig aus Südamerika zurück. Ein schwuler Gigolo habe sie hemmungslos ausgenutzt, da hätte sie nun die Schnauze voll von der Copacabana. In zwei Tagen werde sie am Flughafen ankommen, habe sie Achim mitgeteilt. Achim sollte ja eigentlich nur die Blumen gießen. Dass Marianne die kompletten vier Monate ihres Stipendiums in ihrer Wohnung zu verbringen gedenke, sei der Frau in Südamerika gar nicht bewusst gewesen, obwohl Achim ihr durchaus mitgeteilt habe, dass ein junges schriftstellerisches Talent die Wohnung temporär zum Schlafen nutzen werde. Soweit das Problem, aber die Lösung sei bereits unter Dach und Fach, man müsse nur ein bisschen aufräumen und dann den Umzug am Freitag durchführen. Da haben wir ja noch 36 Stunden, scherzte Marianne, wobei Achim einschränken musste, dass der Akkordeonlehrer darum gebeten habe, nicht vor 15 Uhr bei ihm aufzutauchen. Da wir kein Auto hatten, sollte Mariannes Umzug mit der U-Bahn stattfinden. Ihr Hausrat bestand immerhin aus drei Umzugskartons, zwei Schreibmaschinen und sechs Reisetaschen, dazu noch ein Müllsack mit ihrem Federbett und ihr großer Rucksack. Achim als Organisator und Bescheidwisser meinte, das sei alles kein Problem, er bringe noch ein paar Leute mit, Henry werde doch bestimmt auch gern helfen, vielleicht sogar Ulrich. Jeder nehme einen Gegenstand und Karawanen seien ein seit Jahrtausenden bewährtes Transportmittel, besonders effektiv, wenn man es mit der U-Bahn kombiniere. Seinem Optimismus wussten wir nichts entgegenzusetzen, wechselten das Thema, erzählten endlich unser Abenteuer mit dem Regal im Schnittraum. Das erheiterte uns alle, aber Marianne war es dann doch nicht wohl in ihrer Haut. Ein Bier später wollte sie wissen, was das für ein Akkordeonlehrer sei und ob der denn in dieser Wohnung Akkordeon spiele, oder ob da womöglich nicht nur er, sondern auch noch seine Schüler musikalisch aktiv würden, ganz abgesehen davon, dass sie ja eigentlich gar nicht in einer WG zu wohnen beabsichtige. Achim beschwichtigte: Der sei supernett und spiele supergut und es sei ja vor allem superpraktisch, dass das so schnell ginge, weil Achim das super organisiert habe, sie könne ja mal probieren, eine Wohnung zu bekommen, von Mittwoch auf Freitag.
Ja, das war beachtlich, aber was Achim organisatorisch nicht gelang, war die Verfügbarkeit von hilfswilligen Freunden zu gewährleisten, die unsere Karawane bilden sollten. Meine beiden Designer-Mitbewohner hatten irgendeinen geheimnisvollen Termin, wegen dem sie schon seit Tagen tuschelten. Also standen wir zum vorgesehenen Zeitpunkt, Freitag um 14 Uhr, zu dritt in Mariannes Hauseingang und warteten vergebens auf weitere Helfer. Immerhin hatte ich ein ordentliches Transportrollbrett dabei. Da konnte ich die drei Umzugskartons drauf stapeln, legte noch den Müllsack mit dem Federbett oben drauf und wenn ich auch fast nichts sah, konnte ich die Fuhre ohne große körperliche Anstrengung über den Bürgersteig rollen. Achim schaffte es, die sechs Reise- und Umhängetaschen gleichzeitig zu tragen, Marianne schulterte ihren Rucksack und nahm in jede Hand eine der Schreibmaschinen. Sie arbeite ja lieber mit der mechanischen Reiseschreibmaschine, aber es gäbe auch Momente, da sei es unabdingbar, dass sie die elektrische verwenden könne. Zuhause habe sie sogar noch eine weitere riesige Schreibmaschine für großes Papier, also DIN A3. Verschiedene Maschinen für verschiedene Stimmungen. Leider wisse man ja nicht im Voraus, welche Stimmung sich einstelle und sie wisse auch nicht im Voraus, mit welcher Schreibmaschine sie auf diese Stimmung reagieren müsse. Das sei ihr aber dann, wenn sie schreiben wolle, sofort klar. Die elektrische Schreibmaschine sei mit einer Korrekturfunktion ausgestattet, da könne man bis zu 50 Buchstaben mit der integrierten Tipp-Ex-Rolle wieder verschwinden lassen. Das sei für Anträge und Geschäftsbriefe sehr vorteilhaft. Ob aber künstlerisches Schreiben in einer Wohnung, in der ein Akkordeonlehrer sein Unwesen treibe, überhaupt möglich sei, das könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.
Inzwischen waren wir am Treppenabgang der U-Bahnstation angelangt. Achim ging mit allen sechs Taschen die erste Treppe hinunter, legte diese unten ab, kam mir entgegen, als ich den ersten Karton runtertrug, nahm sich auch einen, dann wir beide nochmal hoch für den letzten Karton, das Rollbrett und den Müllsack mit dem Federbett. Marianne sagte, ihr Rucksack sei schwer, das Absetzen zu kompliziert und mit dem Rucksack die Treppe rauf und runter zu gehen zu anstrengend, ganz zu schweigen von der Gefahr, dass jemand ihre Schreibmaschinen klaue und beteiligte sich deshalb weder an den Umzugskartons, noch an den Taschen und wir erledigten auch den nächsten Treppenabsatz zu zweit mit der gleichen Prozedur, während Marianne alles überwachte. Einer der drei Kartons enthielt viele Bücher, Mariannes Reisebibliothek, und war schwer zu tragen, aber ansonsten ging es leicht von der Hand, zumal wir keine Eile hatten.
Am Bahnsteig angelangt, ließen wir eine U-Bahn vor unserer Nase wegfahren, damit wir zum Einsteigen alles bereitlegen konnten. Es erwies sich als möglich, das Rollbrett mit allen drei Kartons durch geschicktes Hochlupfen von der Bahnsteigkante aus direkt in die U-Bahn hineinzuschieben. Dadurch verlief auch das Einsteigen reibungslos. Wir fuhren einen Umweg, um einen Umsteigebahnhof zu nutzen, bei dem wir am gleichen Bahnsteig bleiben konnten. Allerdings mussten wir auch noch ein zweites Mal umsteigen, und beim zweiten Mal ging es eine Treppe hoch und zwei runter. Da begannen wir zu schwitzen und die dritte U-Bahn war richtig voll. Die anderen Fahrgäste drückten sich ohne zu murren eng zusammen, um uns Platz zu machen. Zu dritt umringten wir unseren Umzugskartonturm mit der Mülltüte oben drauf.
Achim fing an, uns vorzurechnen, dass er ja auch ein Auto hätte ausleihen können. Wenn er denn einen Führerschein hätte. Aber das Auto hätte er in Pankow abholen, über eine Stunde nach Neukölln fahren und danach wieder zurückbringen müssen. Also zwei Arbeitsstunden. Die Fahrt mit dem Auto von Wohnung zu Wohnung hätte schätzungsweise eine Dreiviertelstunde gedauert, während wir jetzt eine Stunde brauchten, allerdings zu dritt, und so hätten wir unter dem Strich eineinviertel Arbeitsstunden gespart. Fragt sich nur, warum so viel Leute mit den Autos hin- und herführen, wenn doch ein Umzug mit der U-Bahn so schön praktisch sei, fragte Marianne. Alles Opfer der Konsumpropaganda, sagte ich, und Achim versuchte mich mit dem Hinweis zu bestätigen, dass drei Freunde ein Auto ersetzten, wobei er aber konkrete Beispiele, wie er das meinte, verschwieg. Mariannes Problem sei nämlich, dass sie nur zwei Freunde habe, also uns beide. Zwei Freunde langten aber nur, um einen Urlaub zu sparen. Nichtsdestotrotz, erwiderte Marianne, fühle sie sich gerade, als habe sie ausgerechnet jetzt einen Urlaub dringend nötig, trotz ihrer zwei Freunde.
Als wir am Ziel-U-Bahnhof die Treppe hochkamen und Marianne auf ihre Frage, wo denn nun die Wohnung sei, erklärt bekam, dass es jetzt leider noch fünf bis zehn Minuten zu Fuß weiterginge, da setzte sie mit einem großen Seufzer ihre zwei Schreibmaschinen ab und sagte, dass sie das nicht schaffe. Achim, der sich gerade mit den sechs Taschen belud, war nicht aus der Ruhe zu bringen. Kein Problem, sagte er, gehen wir eben zweimal. Marianne wurde in ein Straßencafé gesetzt, drei der sechs Taschen blieben bei ihr, ebenso die Schreibmaschinen und der Rucksack. Wir beiden Männer wollten gerade loslaufen, da hielt uns Marianne zurück, weil sie etwas aus dem obersten Umzugskarton herausholen wollte. Eigentlich wären die Kartons, wie sie sagte, nach der Wichtigkeit ihrer Inhalte gestapelt gewesen, oben sei all das drin, was sie jederzeit und überall brauche, aber durch unsere ständigen Treppauf- und Treppabtransporte seien die drei Kartons inzwischen falsch sortiert. Achim hob also den obersten Karton herunter, dann auch den zweiten und schließlich nahm sich Marianne aus dem untersten Karton zwei Blatt Schreibmaschinenpapier, verharrte dann kurz und nahm noch ein drittes Blatt. Drei genügen auf jeden Fall, sagte sie, ihr könnt jetzt gehen. Während wir die Kartons wieder stapelten, wunderte ich mich über uns. Wir hätten uns durch Mariannes Verhalten durchaus die Stimmung verderben lassen können, aber keineswegs, wir waren beide bester Laune und es amüsierte uns, als Marianne uns als letzten Hinweis hinterherrief, dass wir die Kartons in der Wohnung auf jeden Fall wieder entsprechend ihrer Wichtigkeit zu stapeln hätten. Das taten wir dann auch.
Während wir ohne Gepäck beschwingt zum U-Bahnhof zurückgingen, zeigte sich Achim ausnahmsweise ernsthaft besorgt, denn das Problem mit dem Akkordeonlehrer sei ja wirklich eine tickende Zeitbombe. So wie er Marianne kenne, werde spätestens am Montag die Schreibblockade einsetzen, an der dann vordergründig natürlich der Akkordeonlehrer und sein unermüdliches Akkordeonspiel schuld sein werde, aber letztendlich falle das ja auf ihn, Achim, zurück. Er habe zwar Marianne mit dem Versprechen nach Berlin gelockt, sich um eine Unterkunft zu kümmern, aber diese Verwicklungen in Brasilien habe er ja beim besten Willen nicht vorhersehen können.
Ursprünglich, und das erfuhr ich erst jetzt, habe Marianne während der ganzen Zeit ihres Stipendiums in der Uckermark sitzen sollen, dort stehe ein Stipendiaten-Landhaus für sie zur Verfügung, aber die Unsitte, junge Literaten in trostlose Provinzkäffer zu schicken, wo sie für ein paar hundert Mark pro Monat voll der Dankbarkeit für die Stiftung herumzusitzen hätten, habe schon genügend Talente in die Depression getrieben, und deshalb habe Achim mit dem Heimleiter, also dem Literaturagenten und Kunstkurator des Stipendiaten-Landhauses, den Deal ausgehandelt, Mariannes Anwesenheitspflicht in der Uckermark auf einige Pflichtveranstaltungen zu reduzieren, damit sie ihre Zeit stattdessen in den Wohnungen verbringen könne, die Achim für sie in Berlin organisiere. Dort schreibe sie ja viel besser als in dem Landhaus, das, nebenbei bemerkt, zwar idyllisch an einem See läge, aber trotzdem eine nach DDR stinkende alte Bude sei. Dort würde Marianne sofort in Trübsinn verfallen. Was in Berlin nicht der Fall wäre. Außerdem könne er, Achim, sich in Berlin um sie kümmern, da gäbe es ja immer wieder einiges zu tun, um ihre vielen Alltagsprobleme zu klären.
Als wir am Straßencafé ankamen, war Marianne gut gelaunt. Sie hatte tatsächlich ihre mechanische Reiseschreibmaschine geöffnet und klackerte munter mit den Tasten. Dazu trank sie einen Kaffee und meinte, sie würde uns gern erst einmal ein Bier spendieren, das sei sie uns für die Mühen schuldig. Wir hätten es doch bestimmt noch nicht eilig. Bevor sie in die Akkordeonhölle einziehe, müsse sie noch ein paar Gedanken zu ihrem letzten Willen notieren. Sie sagte tatsächlich Akkordeonhölle und Achim begann erneut mit Lobpreisungen des ach so netten Akkordeonlehrers. Marianne meinte, er solle die Klappe halten, sie hätte ja noch zehn Wochen, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Außerdem würde sie das Theaterstück zu Ende schreiben müssen, was aber, ehrlich gesagt, kein Problem sei, denn sie sei bereits so gut wie fertig, nur noch ein paar Korrekturen.
Wie es mit Achims Drehbuch stehe, wollte sie unvermittelt wissen, was Achim überraschte. Er habe eine neue Anfangsszene, in der die Wohnungsprobleme des tragischen Helden stärker betont würden. Der Film müsse unmittelbar damit beginnen, dass der tragische Held einen Einschreibebrief öffne und von der sofortigen Kündigung seines Mietverhältnisses erfahre. Ich fiel ihm ins Wort: erschwerend könne hinzukommen, dass er kein Auto und nur zwei Freunde habe. Achim nahm einen Schluck Bier, dann erklärte er mir geduldig all das, was ich nicht wusste, was aber Marianne schon etliche Mal angehört haben musste, denn sie warf mir einen verschwörerischen Blick zu und tippte dann in beachtlichem Tempo wieder auf ihrer Schreibmaschine herum. Der tragische Held habe gar keine Freunde, aber ein Auto, denn er sei Taxifahrer. Mit Leidenschaft, er liebe sein Taxi und er liebe die Menschen, die er herumfahre, doch diese positive Grundeinstellung bringe ihm immer wieder nur Ärger ein, immer wieder lehne er sich gegen den allgemeinen Defätismus auf und immer wieder sei er der Verarschte. Erst zum Ende wende sich das Blatt und in einem völlig übertriebenen fantastischen Showdown verschwänden seine Widersacher mitsamt der U-Bahn in einer sich plötzlich öffnenden Erdspalte, Berlin werde von einem Vulkanausbruch weitgehend zerstört und der Held erreiche mit dem letzten Tropfen Benzin die Stadt Schwedt, wo er hinfort ein glückliches Leben mit einer Tankstellenbesitzerin führe.
Was für ein erhabener Schwachsinn, dachte ich mir, dazu wusste ich gar nichts zu sagen, abgesehen davon, dass meiner Meinung nach der Vulkanausbruch schwierig zu filmen sein würde. Marianne lugte hinter ihrem inzwischen vollgeschriebenen Blatt hervor: Achim hätte mir alles falsch erzählt, das Ende sei überhaupt nicht wichtig und könne geändert werden, die liebenswürdigen Details im Alltag des Taxifahrers seien die Stärke der Handlung, soweit sie dies aus Achims bisherigen Schilderungen, die ich ja nicht kennen würde, beurteilen könne. Es gebe so viele Taxifahrer, die sich alle den Film anschauen würden, das sei ein riesiges Potential, bemerkte Achim, der noch nicht mal die Anfangsszene festgelegt hatte, aber offensichtlich schon intensiv darüber nachdachte, wie es in der Kinokasse klingelt. Alles recht unrealistisch, sagte ich. Das ist ja die Stärke des Drehbuchs, entgegnete Achim. Marianne zog mit Schwung ihr Blatt Papier aus der Schreibmaschine und sagte: Genau, das denke ich auch, aber jetzt ist es genug, wir gehen!
26
Wir setzten Marianne in ihrem Zimmer ab, stellten die letzten Taschen um sie herum auf den Boden und da sie sich erbat, alles ungestört auspacken zu dürfen, gingen wir. Obwohl Achim eigentlich immer irgendetwas zu erzählen hatte, schwieg er jetzt. Und ich auch. Das Straßencafé erinnerte uns an eine glückliche Zeit, die nur eine halbe Stunde zurücklag. Wir waren uns einig, dass es sich nicht lohnen würde, ohne Marianne nochmal dort herumzusitzen. Also fuhren wir ohne Verzögerung und unsere Wege trennten sich bereits nach zwei U-Bahnstationen.
Dann befand ich mich allein zwischen den Menschen, die Zeitungen und Bücher in den Händen hielten. Hatte ich bei der Hinfahrt einen ganzen Umzugskarton voll mit der Reisebibliothek von Marianne dabei, musste ich mich jetzt mit dem zerflederten Rest einer Tageszeitung, die liegen geblieben war, zufrieden geben. Regierungswechsel in Italien, ein gewisser Silvio Berlusconi, Medienunternehmer, hatte die Regierung übernommen. Angeblich unglaublich reich, unglaublich einflussreich und unglaublich manipulativ, schrieb die Berliner Boulevardpresse und versuchte offensichtlich, mich ebenfalls zu manipulieren. Mit einem Foto, das unweigerlich dazu führte, dass einem dieser Mann mit dem selbstgefälligen Grinsen sofort unsympathisch war. Der Text lieferte die passenden Fakten zur impulsiven Beurteilung des Fotos. Das Foto war zweifellos gut ausgewählt worden, oder sah dieser Mensch auf allen Aufnahmen so abschreckend aus? Ich fragte mich, wie viele Agenturfotos am Wahlabend von einem Wahlsieger geschossen werden. Tausende? Wie viele sortieren davon die Fotografen aus? Wie viele Fotos lagen damals einer deutschen Zeitung vor, wenn sie abends die Wahlergebnisse aus dem 2000 km entfernten Rom bekam? Inzwischen hat sich die Anzahl der Fotografen vermutlich vermehrt, die Anzahl der Fotos vervielfacht. Über das Internet schwappt bei jedem öffentlichen Ereignis eine Welle von Bildern über die ganze Welt. Vielleicht hatte damals die Redaktion nur ein brauchbares Bild? Jenes mit dem selbstgefälligen Grinsen. Bestimmt nicht.
Ohne konkreten Grund nahm ich die Zeitung mit, als ich die U-Bahn verließ und nach Hause ging und hoffte, meine beiden WG-Mitbewohner würden in der Küche sitzen. Aber sie wähnten sich gerade auf einer höheren Bewusstseinsebene. Wegen dem Power Mac, den sich Henry am Nachmittag gekauft hatte. Das also war das Geheimnis der beiden gewesen, ein neuer Computer, das Super-Top-Modell, in dem ein Prozessor verwendet wurde, der zu einer neuen Generation gehörte, angeblich sensationell schnell, schneller als die anderen Macs und mit einer Dose, wie damals ein Rechner mit DOS-Betriebssystem genannt wurde, überhaupt nicht zu vergleichen.
Leider gab es keine Möglichkeit, mir diese Rechenleistung zu demonstrieren, denn die beiden schoben stapelweise 3,5-Zoll-Disketten in das Laufwerk und installierten irgendwelche Software, wobei sie von jedem Programm behaupteten, dass es total geil sei. Ab und zu begeisterten sie sich für eines der Computergeräusche, die der Mac ausstieß. Mich erheiterte ihre merkwürdige, kindliche Freude. Ansonsten schaute ich ihnen mit nur mäßigem Interesse über die Schulter. Nebenbei erzählte Henry, dass die Kiste schweineteuer gewesen sei, aber die Firma, in der er arbeite, habe einen großen Auftrag von einem Automobilkonzern bekommen. Eine ganze Serie hochwertig gestalteter Broschüren für eine neue Zielgruppe, kombiniert mit einer darauf abgestimmten Internetseite, und weil sie dafür weitere Leute einstellen wollten, sei er in der Hierarchie nach oben gerutscht. Es sei damit zu rechnen, dass er im nächsten halben Jahr total ranklotzen müsse, aber er habe sich schon einmal im Voraus dafür belohnen wollen. Er sei ja einer der ersten in der ganzen Stadt, der so einen Power Mac besitze. Zwar gelang es ihm nicht, mir begreifbar zu machen, worin der technologische Quantensprung, der diesem Computer nachgesagt wurde, bestand, trotzdem herrschte bei beiden Designern ungetrübte Weihnachtsstimmung. Was wird aus dem kleinen? fragte ich mit Unschuldsmiene. Den kannst du haben, antwortete Henry, Ulrich will ihn nicht. Ulrich erklärte, dass er sich demnächst auch einen Power Mac holen würde, er müsse nur noch ein bisschen sparen und Henry fuhr fort, dass ich auf jeden Fall den alten Mac nehmen solle, denn mir traue er zu, dass ich mir aus reinem Pragmatismus, oder gar aus Sparsamkeit, eine Dose kaufen könnte und das müssten sie, Ulrich und er, als kulturbewusste Menschen auf jeden Fall verhindern, einerseits, um mich vor diesen abscheulichen Windows-Rechnern zu bewahren, andererseits wäre die Harmonie unsere Wohngemeinschaft durch eine solche Inhomogenität der Betriebssysteme ernsthaft gefährdet. Wer einen DOS-Rechner hat, den will Henry nicht als Freund haben, warf Ulrich ironisch ein. Das will ich wirklich nicht, meinte Henry mit unerwarteter Ernsthaftigkeit. Vierhundert und er ist deiner! Außerdem würde es ihm den Abschied erleichtern, wenn der kleine Mac im Haushalt bleibe. Das dachte ich mir auch, aber umgekehrt, denn es wäre ja ganz praktisch, wenn ich den Rechner von Henry übernähme. Dann könne er mir helfen, wenn ich nicht weiter wüsste, sagte ich. Du wirst keine Hilfe brauchen, das sei ja das Gute an dem Gerät, während bei einer Dose ein Technikfreak für den Computer und ein Psychiater für die mentalen Folgeschäden erforderlich seien. Trotzdem käme bei der Benutzung nichts Brauchbares raus. Ulrich nickte zu Henrys Polemik.
Ich ging in mein Zimmer und sah die alte Schreibmaschine auf meinem Arbeitstisch stehen, im Regal daneben die vielen Aktenordner mit den abgehefteten Ideensammlungen, Zeitungsausschnitten und Entwürfen. Ich musste mich auf die Zehenspitzen stellen, um den Schreibmaschinenschutzdeckel vom obersten Regalbrett herunterzuziehen. Dann stülpte ich ihn über die Maschine und schob sie unter den Schreibtisch. Ich hätte sie auch gleich in den Keller bringen können, denn ich benutzte sie tatsächlich nie wieder, kein einziges Mal. Ohne Henry und Ulrich bei ihrer wichtigen Installationstätigkeit am Power Mac zu stören, holte ich mir den kleinen Mac aus Henrys Zimmer, stellte ihn auf meinen Schreibtisch. Er sah gut aus, aber bevor ich ihn einschaltete, ging ich zum Geldautomaten und zog die gewünschten 400 Mark. Ulrich und Henry staunten, als ich das Geld auf den Tisch legte. Ich glaube, sie wollten etwas Witziges sagen, aber es fiel ihnen nichts ein. Während sie noch nach Worten suchten, klingelte das Telefon. Es war Marianne, die sehr paranoid klang: Hörst du es? Es ist so weit, er spielt. Dann verstummte sie und so sehr ich mich auch bemühte, etwas zu hören, waren es doch nur verwaschene Geräuschfetzen, die aus dem Hörer drangen. Akkordeonmusik konnte ich beim besten Willen nicht wahrnehmen. Er spielt, sagte sie. Hörst du es nicht? Ich meinte, es sei sehr leise. Ja genau, das ist das Problem, erwiderte Marianne, es sei so leise, dass es sie in den Wahnsinn triebe. Wäre es noch leiser, würde sie es gar nicht hören, wäre es etwas lauter, könnte sie es als Musik empfinden, aber es sei dazwischen, so dass sie die Musik nicht hören würde, solange sie auf den Tasten ihrer Schreibmaschine herumklappere, aber sobald sie eine Pause einlege, dringe die unterschwellige Akkordeonmusik in ihr Hirn ein und lege sofort alle Bereiche lahm, die dazu geeignet wären, Literatur zu erzeugen. Was sollen wir dagegen unternehmen? fragte ich. Marianne antwortete überraschend gefasst: Nichts! Sie müsse sowieso noch mal in die Uckermark, dort könne sie zwei Tage länger bleiben, um die letzten Korrekturen am Stipendiaten-Text vorzunehmen und danach wäre die verbleibende Zeit in Berlin am besten damit zu nutzen, dass sie Akkordeon lerne, oder hätte ich eine bessere Idee? Oh ja, da fielen mir mehrere auf Eis liegende Projekte ein, bei der ihre Hilfe wertvoll sein könnte, oder der Zeichentrickfilm und mein neuer Computer. Das würde wohl genügen, sagte sie, unterbrach kurz das Telefonat, weil offensichtlich jemand mit ihr redete und berichtete mir dann, dass die Freundin des Akkordeonlehrers sie gerade darauf hingewiesen habe, dass in wenigen Minuten ein Gemüseauflauf serviert werde, um sie in der Wohnung willkommen zu heißen. Dann sei doch alles bestens, sagte ich, aber Marianne verriet mir flüsternd, dass sie weder Gemüseaufläufe noch WG-Kochabende leiden könne. Doch als kleine Stipendiatin habe man ja keine Wahl, man müsse das alles über sich ergehen lassen, diese Begrüßungs-, Verabschiedungs-, Kennenlern- oder Belobhudeligungsveranstaltungen, Bergfeste, gesellige Abende, Besichtigungen und Einladungen bei Kulturfunktionären und Bürgermeistern. Aber sie sei im Kapitalismus angekommen und habe kapiert, was man für die 800 Mark pro Monat von ihr erwarte. Das Schreiben ihres Theaterstücks würde sie umsonst und sowieso machen, daran könne sie niemand hindern. Das Geld sei zum Überleben und für den Kulturrummel. Ich mischte mich ein: Der Gemüseauflauf werde das Verhungern verhindern und das gemeinsame Essen Hinweise auf die sozialen Gesetzmäßigkeiten ihrer neuen Wohnstätte geben, das diene doch letztendlich alles dem Erkenntnisgewinn und ohne Erkenntnisgewinn habe man nichts mitzuteilen und damit seine Berechtigung als Literat verwirkt. Widerspruchlos nahm Marianne meine Belehrung hin, sie gab sogar zu, dass sie Hunger habe und sowohl der Akkordeonlehrer als auch seine Freundin sympathische Menschen zu sein schienen. Sympathisch genug für ein Abendessen allemal, wenn sie nur nicht mit ihnen wohnen müsste, das beunruhige sie sehr. Ich wünschte ihr Guten Appetit und legte auf.
Danach kochte auch ich einen Topf Nudeln, aber meine beiden Mitbewohner waren nicht von ihrem Computer wegzulocken, sie hockten da den ganzen Abend. Ich hatte keine Ahnung, was es so lange zu tun gab.
27
Das einzige, was einen noch schlechteren Ruf als die Fernsehberichterstattung des Privatfernsehens hatte, waren die Seifenopern. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es die noch gar nicht. Seifenopern dreht man in einem Studio, das man sich als Mischung aus Möbelhaus und Lampenladen vorstellen muss. Unten sind die einzelnen Handlungsorte aufgebaut, also die Stammkneipe, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche. Oben drüber hängen unglaublich viele Scheinwerfer. Die Schauspieler und diejenigen, die als solche bezeichnet werden, spielen dann ihre Dialoge und werden von drei bis vier Kameras gleichzeitig gefilmt. Ab und zu muss dann doch mal eine Szene in der realen Welt gedreht werden, also auf Straßen oder im Wald, aber auch an Schauplätzen, für die es sich nicht lohnt, sie im Studio aufzubauen: Schwimmbad, Fitnessstudio, Parkhaus. Durch eine glückliche Fügung war ich als Kameraassistent bei dem Team gelandet, das nur diese Außenaufnahmen im klassischen Stil mit einer Kamera drehte, wofür zwei bis drei Tage pro Woche veranschlagt waren. Anstrengende, lange Tage, meist Donnerstag und Freitag. Der Kameramann war viel älter als ich und hatte sein Leben lang immer mit chemischem Film gearbeitet, was damals bei Filmen und Serien normal war. Die neumodischen Videoapparate waren ihm suspekt und nicht vertrauenswürdig. Aber jetzt waren wir bei den Pionieren der Billigunterhaltung gelandet, wo man erkannt hatte, dass Fernsehreportagekameras für die Umsetzung banaler Handlungsstränge schneller, billiger und trotzdem gut genug waren. Meine Aufgabe bestand darin, den Kameramann von seiner Angst, die Videoaufzeichnung könne versagen, zu befreien. Ansonsten machte ich, was Assistenten eben machen: Technik transportieren, aufbauen, umbauen, abbauen, Akkus wechseln, Akkus laden, Kassetten beschriften und dafür wurde ich überraschend gut bezahlt. Dem Job bei der kleinen Produktionsfirma weinte ich unter diesen Bedingungen keine Träne nach. Der Chef war inzwischen untergetaucht und die Rechnungen und Mahnungen, die ich ihm schickte, hätte ich mir sparen können, das Honorar der letzten drei Monaten kam nie bei mir an. Aber die Seifenoper sanierte mich schnell und in jeder Woche hatte ich nach den zwei Arbeitstagen fünf Tage frei. Zunächst am Wochenende entspannen und dann blieben noch drei Tage für andere Auftraggeber oder eigene Filme.
Im Hinterhofkino startete der Hinterhofkinoprogrammdirektor eine wöchentliche Reihe mit unabhängig produzierten Kurzfilmen. Um sicher zu sein, dass meine Werke regelmäßig vertreten wären, half ich bei der Organisation und versprach, ab und zu auch mal als Vorführer mitzumachen. Allerdings stellte sich bald heraus, dass Super-8-Filme nur die Ausnahme bilden sollten und deshalb brauchte ich dringend noch mehr Werke auf 16 mm. Auch in anderen Bars, die sich kulturell ein bisschen aufplustern wollten, hatte man inzwischen einen der unzähligen tschechischen Filmprojektoren in der Ecke stehen, die alle angeblich aus irgendwelchen DDR-Kulturinstitutionen stammten. Je nach angestrebtem Subkulturintensitätsgrad gab es wöchentlich, monatlich oder unregelmäßig Filmabende mit den Werken der cineastischen Basis, zu der ich mich zählen durfte. Außer dem „Abschied“ hatte ich inzwischen zwei kurze und sehr einfache Zeichentrickfilme auf 16 mm fertiggestellt, ein dritter war in Arbeit. Da ich mir in den Kopf gesetzt hatte, diesmal alle Zeichnungen farbig auszumalen, gab es an meinen vielen freien Tagen viel zu tun, damit ich bei vielen Filmabenden mit dabei sein konnte. Viele Zuschauer gab es da leider nicht. Fünfzehn bis fünfzig, manchmal auch nur fünf. Wenn dann die Filme zu Ende waren, kamen Gäste, die nur trinken wollten und quatschten schlau daher. Filme? Wie interessant, was denn für welche, muss ich mir mal anschauen. Aber dann nie wieder auftauchten. Trotzdem kam ich ganz gut herum, lernte andere Filmkulturpartisanen kennen und kannte inzwischen mehr Szenekneipen als Achim und Martin. Immer noch entstanden viele verborgene oder halblegale Bars im Ostteil der Stadt und es war die Zeit, in der es sich einbürgerte, jeden banalen Tresen, an dem ein paar Trinker lehnten und dabei Musik hörten, als Club zu bezeichnen. Durchs Nachtleben zu streifen, immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wo ich mich mit meinen Filmen reindrängeln konnte, gehörte zu meinem selbstgewählten Kulturauftrag. Jetzt hatte ich die richtigen Rahmenbedingungen dafür, denn abgesehen von meinen Arbeitstagen bei der Seifenoper oder anderen Kameratagelöhnerjobs konnte ich lang schlafen, ausgiebig Kaffee trinken und dann zeichnen. Manchmal kam jemand vorbei, um mir dabei zu helfen, am häufigsten Marianne. Ihr Leben beim Akkordeonlehrer schien gar nicht so quälend zu sein, wie von ihr vorhergesehen. Das gab sie aber nicht zu. So wie sie redete, war die Welt ihr gegenüber grundsätzlich feindselig und stellte sich ihrem Schreibbedürfnis in den Weg. Das Schreiben musste in einem permanenten Kampf gegen diese Widrigkeiten verteidigt werden. Die Angst, zu versagen und ganz hineinzufallen in die Geborgenheit der kapitalistischen Lohnarbeit kostete uns eine Menge Kraft. Auch Marianne schien diese Angst zu spüren, dabei war sie noch ganz unschuldig: Vier Semester Germanistik und Kulturwissenschaften, dazu ein paar Literaturwettbewerbe und das Stipendium, da musste sie sich noch nicht positionieren. Ich merkte trotzdem, wie sie das, was ihr eigentlich helfen sollte, das Studium und das Stipendium, als Widerstand empfand. Ulrich war zu dem Zeitpunkt sehr zufrieden, weil es ihm gelang, anspruchsvolle Aufträge zu bekommen, kritischer Fernsehjournalismus, während Henry ganz in die Propagandamaschinerie des Autokonzerns hineingetaucht war. Wenn wir uns ab und zu zuhause trafen, schwärmte er nicht nur von den schier unbegrenzten Möglichkeiten und Budgets, die seiner Agentur für die Werbekampagnen zur Verfügung standen, sondern auch von technischen Details und Design-Finessen der Autos. Er hatte eine charmante, intellektuelle Art, wie er von seiner Arbeit erzählte. Seine eingestreuten ironischen Bemerkungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass er voller Enthusiasmus dabei war. Mit Bewunderung beschrieb er, welch technische und organisatorische Aufwand betrieben wurde, um die bestmöglichen Fotos an den schönsten Orten der Welt zu machen und, sofern nötig, auch noch die schönsten Frauen daneben zu stellen, neben das Produkt. Aber bald sei das ausgereizt, meinte er, inzwischen werde jeder Kaugummi mit einem Hubschrauberflug über die Skyline von Manhattan beworben, das ginge nicht mehr lange so weiter. Da kommt dann irgendwann jemand, der macht eine Werbekampagne, die sieht SO aus, und dabei deutete er auf die Trickfilmzeichnung, bei der ich gerade den Himmel blau ausmalte. Bestimmt nicht, das ist viel zu schlampig, meinte ich, doch Henry ließ sich nicht beirren. Ihm würden die Zeichnungen gefallen, das sei ein schöner Gegenentwurf zu dem super-perfekten Design, das er bei der Arbeit abliefern müsse. Irgendwann werde ein Marketingexperte diesen Stil als zielgruppenrelevant erkennen und ausnutzen. Auch eine Ästhetik, die aus der Abgrenzung entstanden sei, könne instrumentalisiert werden, es ginge nur darum, die Kommunikationskanäle soweit einzugrenzen, dass die Zielgruppen herausgefiltert werden könnten. Da die Digitalisierung langsam in Fahrt käme, sei er zuversichtlich, dass wir diese Eingrenzung der Kommunikationskanäle noch erlebten und dann werde die Werbung wie ein Kumpel sein und könne sowohl schäbig oder schlampig aber auch extravagant daherkommen. Ich protestierte. Meine Zeichnung sei analog und meine kleine Zielgruppe werbefeindlich. Sie solle vor dem Kapitalismus geschützt und ihm nicht ausgeliefert werden. Henry durchschaute, wie blauäugig ich in dieser Hinsicht war. Er versuchte mir zu erklären, was ich nicht verstehen wollte: Auf meine Zielsetzung käme es gar nicht an, ich habe da alle Freiheiten, aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis jemand versucht, meine Zielgruppe mit meinen Stilmitteln anzubaggern. Je konsumkritischer eine Zielgruppe sei, desto unauffälliger und verlogener müsse sich die Werbung unter falscher Flagge einschleichen, anbiedern, aufdrängen. Jahre später, als ich den Fischfilm, den ich damals malte, ins Internet stellte, erschien neben ihm tatsächlich eine Werbung für Aquarien und Zierfische. Als ich die Werbung sah, erinnerte ich mich an Henrys Prognose und atmete auf. Diese Zielgruppentreffgenauigkeit empfand ich keineswegs als Gefahr, weder für mich noch für meine Freunde, die selbst entscheiden konnten, ob sie Zierfische haben wollten. Dabei ging es bei meinem Zeichentrickfilm gar nicht um Fische, sondern um ein kleines Mädchen, das beim Angeln ins Wasser fällt, in das Fischernetz eines Kutters gerät und in der Dosenfischfabrik gerade noch gerettet wird. Das war eine witzige Geschichte, die nichts mit Systemkritik zu tun hatte, aber sie war außerhalb der Mechanismen der Unterhaltungsindustrie entstanden, gehörte zur Subkultur und deshalb störte es nicht, wenn sie ungelenk hingekritzelt war. Ich gab mir beim Zeichnen wenig Mühe. Ein begnadeter Zeichner war ich sowieso nicht. Dieser schlampige Stil vergrößere die Distanz zu den professionellen Filmen und genau das gefiel meinen Zuschauern in den Hinterhofkinos und Subkulturkneipen. Weil die Hintergrundflächen in jedem Bild mit Wachsmalkreiden von Hand ausgemalt waren, flimmerten dieses Flächen im Film. Dieser Effekt verstärkte sich noch, weil alle freiwilligen Gehilfen beim Kolorieren einen eigenen Stil pflegten. Ungefähr zwei Monate lang sollten meine Freunde spontan oder angekündigt vorbeikommen, um mir dabei zu helfen 1200 DIN-4-Zeichnungen auszumalen und wurden mit Kaffee, Kuchen, Wein und Bier versorgt. Henry kolorierte ganz präzise, aber er hatte gleich einschränkend gesagt, er werde nur Kleinigkeiten ausmalen, zum Beispiel Schuhe oder Mützen, keine großen Flächen. Martin kam gar nicht, er war zu beschäftigt und Ulrich, der nur einmal mitmachte, drückte die Stifte nicht richtig auf, so dass es bei ihm alles nach Pastellfarben aussah. Marianne hingegen war praktizierende Ausmalanarchistin, die sogar große Hintergründe kreuz und quer kritzelte, wie es kleine Kinder machen. Achim versuchte es ordentlich, schaffte das aber nie, manchmal verwechselte er sogar die Farben. Sabine war stilistisch merkwürdig uneinheitlich. Beim ersten Mal hatte sie ihre Kind dabei und schraffierte ein paar große, blasse Flächen, dann musste sie sich um ihre quengelnde Tochter kümmern.
Ein paar Wochen später kam sie allein. Diesmal bemalte sie mittelgroße Flächen von außen nach innen. Wie bei einer Landkarte, sagte ich, und sie meinte: Wie eine Geografin. Ob sie sich denn als Geografin fühle, fragte ich, aber sie meinte, sie fühle sich vor allem als Mutter, auch wenn sie zurzeit einige Seminare besuche. Mehr Seminare als in der Zeit vor der Schwangerschaft. Sie wisse ja gar nicht mehr, was sie damals alles vom Studieren abgehalten habe. Rückblickend erschien es ihr, als sei überhaupt keine Zeit zum Studieren gewesen, ständig Verabredungen und wichtige Veranstaltungen, all diese bedeutenden Kultur-Events, Filmfestspiele, Biennalen und Ausstellungseröffnungen, Wochenendausflüge, Kurztrips quer durch Europa und ab und zu auch mal eine Affäre, wobei die Wochenendausflüge und Kurztrips meist mit den Affären gekoppelt gewesen seien und die Kultur-Events und Ausstellungseröffnungen dazu gedient hätten, diese einzuleiten.
Jetzt habe sie NUR das Kind, das durchaus seine Zeit beanspruche, aber das sei letztendlich eine gute Zeit. Ansonsten kümmere sie sich um das Studium, das so gut wie fertig sei. Und dann? fragte ich, obwohl es mich gar nicht interessierte. Eigentlich wollte ich mehr über Sabines Affären hören, aber das „Und dann?“ war reflexartig herausgerutscht und ebenso reflexartig begann Sabine wieder davon zu erzählen, dass sie sich eine Doktorandenstelle unter den Nagel reißen könne, in Berlin oder anderswo, wobei das anderswo mit dem Kind nicht mehr so günstig sei wie damals, als sie kinderlos war. Während sie erzählte, kreiste ihr Stift beim Ausmalen und sie schaute ihn konzentriert an. Die langen blonden Haare fielen mit den Spitzen bis auf das Papier und bildeten eine Verbindung zwischen ihr und der Zeichnung. Schließlich bemerkte sie, dass ich sie anschaute und warf mir einen kurzen liebevollen Blick zu, dessen Interpretation mich in Zweifel stürzte. Sollte er bedeuten, dass sie dringend die nächste Affäre brauchte, und zwar mit mir, oder war es die kumpelhafte Beschwörung, dass wir uns, nach all den Affären, die sie mit anderen haben würde, immer noch gut verstehen könnten?
Vermutlich Letzteres, denn als sie weiter über ihre Berufsaussichten redete, ließ sie sich doch noch zur Schilderung einer unergiebigen Liebschaft mit einer Person aus dem Lehrkörper, wie sie ihn bezeichnete, hinreißen. Das ließ offen, ob es sich um einen Assistenten, einen Dozenten oder einen Professor gehandelt hatte. Doch wie ich sie inzwischen einschätzte, war es mindestens ein Professor gewesen, wenn nicht sogar der Institutsleiter. Der Sex sei so fade und die dazugehörige Person so eingebildet gewesen, dass sie verbrannte Erde habe zurücklassen müssen und jetzt sei die von ihr zunächst als gut eingeschätzte Jobperspektive extrem aussichtslos. Es sei in der Tat sehr töricht von ihr gewesen, sich auf dieses Verhältnis einzulassen, aber der Charme und die tadellosen Maßanzüge der fraglichen Person hätten sie schwach werden lassen. Im falschen Moment und als strategische Maßnahme zur Verbesserung der Karriereperspektive total kontraproduktiv. Er habe es ja darauf abgesehen gehabt, dass sie einmal pro Woche seine Fickgespielin sein sollte, vielleicht auch noch auf zwei Dienstreisen pro Jahr, aber bei ihr sei die sexuelle Anziehung ganz schnell in puren Ekel über die Selbstgefälligkeit der fraglichen Person umgeschlagen. Jetzt habe sie den Salat. Wenn sie bis zum Ende ihrer Diplomarbeit das unkritische Betthäschen geblieben wäre, sähe alles besser aus. Dann schnappte sie sich eine neue Zeichnung und malte einen der vielen Fische knallrot aus, was falsch war, die Fische sollten bräunlich-grün sein. Aber ich war von ihren offenherzigen Ausführungen so überrascht, dass ich darauf verzichtete, sie wegen dieses Fehlers zurechtzuweisen.
28
In dem Moment kam Marianne dazu, unangekündigt, aber sie wusste ja, dass ich am Wochenende mit den Farbkreiden am Tisch saß und auf Gäste wartete. Keinen Kaffee, sagte sie, sie müsse jetzt dringend zur Beruhigung ein paar Fische anmalen, und obwohl ich ihr Sabine vorstellte, nahm sie diese so gut wie nicht zur Kenntnis, sondern ereiferte sich darüber, dass Achim ruhig gestellt werden müsse, er liege ihr ständig mit seinem Taxifahrer-Epos in den Ohren. Sie könne das nicht mehr hören, es sei höchste Zeit, dieser Misere konstruktiv in die Augen zu blicken.
Beim Hinsetzen deutete sie auf Sabines letztes Blatt und erklärte, es freue sie, dass endlich auch rote Fische in meinem Zeichentrickfilm erlaubt seien. Ich sagte nein, aber das beeindruckte sie gar nicht, vielmehr schnappte sie sich den roten Stift und ein Blatt vom Stapel und schon wurde der nächste Fisch rot angemalt, denn es könne ja nicht sein, dass Sabine rote Fische malen dürfe und sie nicht. Mein langweiliger Realismus, die Fische grünlich-bräunlich und blau schimmernd auszumalen sei sowieso ziemlich verklemmt. Das sagte sie, als Sabine gerade wieder, so wie es von mir vorgesehen war, die blaue Kreide nahm, um einen Fisch auszumalen. Dann fuhr Marianne fort: Achim käme unter dem Vorwand, er müsse die Lage zwischen ihr und dem Akkordeonlehrer beobachten, beschwichtigen oder beruhigen, jeden zweiten Tag bei ihr vorbei und erzähle ihr eine neue Variante seiner Filmideen. Speziell die Anfangsszene sei permanenten Änderungen unterworfen. Das gehe nicht so weiter, aber wozu hätte ich denn diesen hübschen kleinen Computer gekauft, der sei doch wie dazu geschaffen, dass wir uns zu dritt hinsetzten und die schwachsinnigen von den grandiosen Ideen trennten und den Drehbuchentwurf in ein Textverarbeitungsprogramm hineintippten, damit Achim diese Version für seine Anträge von Fördergeldern und sonstigen Akquisitionsbemühungen nutzen könne.
Ob es sich bei Achim um den Achim handle, den sie schon aus unserer süddeutschen Zeit kenne, fragte Sabine. Als ich das bejahte, meinte sie, dass sich das nicht lohne. Achim hätte sie schon zweimal in Diskussionen verwickelt und ihre Einschätzung laute: Achim sei schlicht und ergreifend ein Großmaul, aber kein kreativer Geist. Wenn sie nun höre, dass er immer wieder neue Ideen anbringe, dann müsse sie aus ihrer Erfahrung sagen, dass Ideen, die sich ständig wandelten, genauso nutzlos seien, wie nicht vorhandene Ideen. Der Prozess, der jetzt beginne, entgegnete Marianne, bestehe in der Festlegung. Ideen diskutieren, formulieren, hinschreiben, ausdrucken, Antrag stellen, fertig.
Großmaul sein sei eine der immer wieder unterschätzten Charaktereigenschaften, behauptete ich. In unserer Gesellschaft der Chancengleichheit müsse man leider unglaublich viele Konkurrenten in den Schatten stellen. Dabei könne ein großspuriges Auftreten die Ausgangsbedingungen durchaus verbessern. Sabine malte den nächsten Fisch bräunlich-grün an, widersprach mir aber vehement. So wie sie das Wort Großmaul verstehe und benutze, bedeute es, dass die entsprechende Person keineswegs ein gesundes Selbstvertrauen habe, was durchaus eine gute Ausgangsposition für jegliches soziale Handeln sei, sondern dass es sich um eine Person handle, deren Qualifikationen deutlich und offensichtlich von der Selbsteinschätzung und -darstellung abwichen, und zwar im defizitären Sinn. Und dies sei bei Achim der Fall. Es mache wenig Sinn, seine fixen Ideen aufzupäppeln. Das solle uns aber nicht davon abhalten, ihn als Freund zu schätzen oder sich mit ihm die Zeit zu vertreiben. Wir könnten auch seine durch und durch subjektive Wertschätzung nutzen, um unser eigenes Selbstvertrauen damit zu pflegen. Denn so wie sie es erlebt habe, sei Achim vermutlich mein größter, oder zumindest mein lautester Fan und sie, Sabine, könne sich gut vorstellen, dass er auch Mariannes Werk genauso lautstark anpreise. Ja, das würde er manchmal tun, doch zur Zeit redet er nur von seinem Taxi-Film an, beschwerte sich Marianne, und sie sei tief in seiner Schuld, dass müsse sie zugeben. Achim kümmere sich in der Tat unermüdlich um viele ihrer Angelegenheiten. Außerdem sähe sie durchaus Potential in Achims Drehbuchidee, es gäbe in der Kultur- und Kunstszene eine gewisse Unberechenbarkeit, und das Thema Taxi, da müsse sie Achim Recht geben, passe gut zum urbanen Zeitgeist. Es komme eben darauf an, wie man es ausgestalte. Außerdem ginge es ja nur darum, ein Treatment zu schreiben, oder ein Exposé, eben einen Text, in dem drin steht, wie man sich den Film vorstellen müsse. Damit könne man dann Drehbuchförderung beantragen. Und bekommen, aber bis dahin vergehe erst einmal ein Jahr. Sie könne dann helfen, wenn das Drehbuch ausgearbeitet werden soll. Sie wisse schon, dass es beim Film lukrativere Möglichkeiten gäbe als beim Theater. Außerdem gehöre es manchmal auch dazu, und bei dieser Erklärung wandte sie sich explizit an Sabine, das Unwahrscheinliche und Außergewöhnliche zu versuchen, denn das Normale, Naheliegende und Rationale machten sowieso viel zu Viele. Sie könne durchaus grüne Fische malen, aber nur, wenn es sein müsse.
Ja, es muss sein, sagte ich mit Bestimmtheit und dabei nahm ich ihr den roten Stift aus der Hand, mit dem sie gerade weitermachen wollte. Das sei mein Film, ich habe tagelang dafür gezeichnet, wochenlang, monatelang. Wer sich bereit erklärt, mir beim Ausmalen zu helfen, hat sich der stillschweigenden Übereinkunft zu unterwerfen, dass meine Vorgaben eingehalten würden. Wer rote Fische malen wolle, könne dies ausgiebig zuhause in Öl und auf Papier praktizieren, aber nicht bei mir. Jawohl Chef, sagte Marianne, und Sabine wiederholte diese prägnante Formulierung ebenso zackig, also mit der gleichen Mischung aus Ironie und Zustimmung. Ob denn Achim eine Beziehung mit Marianne anstreben würde, fragte Sabine, als wir uns alle drei über die Zeichnungen beugten und weitermalten. Ohne hochzuschauen antwortete Marianne, dass dieses Thema schon lange geklärt sei, da gebe es nichts mehr zu diskutieren. Nachdem sie ihn abblitzen habe lassen, sei er zum großen Bruder mutiert, der sich für all ihre irdischen Probleme verantwortlich fühle. Ich wunderte mich, wieso ich das nicht wusste aber ich hatte ja nie gefragt.
Marianne begann nun, über ihren Ex-Freund herzuziehen, der ebenso wie Achim einen Helferkomplex habe und der aus gutem, wenn nicht gar allerbestem Hause käme, was ihn damals, zu Abiturzeiten, erst recht dazu animiert habe, sich der hilfsbedürftigen Mitschülerin mit den romantischen literarischen Ambitionen anzunehmen. Das habe sie gar nicht leiden können, und sie scheiße auf die gute Beziehung, die der Vater ihres Ex-Freundes sowohl zum Lektor, als auch zum Direktor des ortansässigen bedeutenden Verlagshauses gehabt habe. Wenn die Typen älter seien, wollten sie sich eine junge Geliebte als Statussymbol halten, wenn sie jung seien, nähmen sie eine Künstlerin, die dann wie ein Rennpferd gehegt und gepflegt werde, damit man sie erfolgreich ins Rennen schicken könne, aber das funktioniere nur mit den schlechten Künstlerinnen, die durch diese umfangreiche Unterstützung und vielfachen Beziehungen trotzdem gut im Geschäft seien. Wenn nicht sogar besser als die tatsächlich guten Künstlerinnen! Am Anfang könne man als begabtes, ungesponsertes Individuum noch mithalten, aber die Zeit arbeite für die Rennstall-Künstlerinnen, sie hätten den längeren Atem in Form der monatlichen Leibrente und ihrer mit allen Wassern gewaschenen Unterstützer. Man könne sie nur ausbremsen, indem man es schaffe, unmittelbar nach dem Studium in die Professionalität zu springen, mit all den dazugehörigen Risiken. Risiken, wie die überall lauernden Typen aus der Unterhaltungsindustrie und Werbebranche, die unzählige junge Talente abfingen, damit die einfacheren Gemüter unter ihnen Seifenopern und die anspruchsvolleren Werbekonzepte produzierten. Ich reagierte nicht auf ihren Seitenhieb. Stattdessen konzentrierte ich mich auf die vielen Details meiner eigenen Zeichnung und behielt dabei die malerischen Aktivitäten der Frauen im Blick. Ich bearbeitete die komplizierten Motive, ganz davon abgesehen, dass ich sie mir ausgedacht hatte.
Sabine und Marianne blieben noch lang, mehrere Stunden, redeten sowohl miteinander als auch mit mir, aber sie erweckten den Eindruck, als könnten sie nichts miteinander anfangen. Es schien mir, als warteten beide darauf, dass die andere endlich ginge, damit die Zurückbleibende über die andere lästern könnte. Ich fühlte mich nicht behaglich dabei, malte und malte, während das Gespräch sich immer mehr um die üblichen, banalen Berliner Kulturthemen drehte, was schließlich unverfänglich genug war, um mich zu beruhigen. Obwohl Marianne an jenem Nachmittag vergleichsweise ernsthaft argumentiert hatte, erschien sie mir im Vergleich zu Sabine aufgedreht, naiv, zwanghaft, aber sehr unterhaltsam. Zum Blumenrock trug sie ein orangenes King-Kong-T-Shirt, während Sabine in blass gefärbtem Öko-Leinen eine Ikone der kultivierten Langeweile abgab. Eine um Kultur bemühte, großbürgerliche Edel-Schlampe, die mit ihren abgeklärten, pragmatischen Ratschlägen viel zu oft Recht behielt. Das gönnte ich ihr nicht, ich wollte, dass sich meine ideologisch fundierte Künstlerweltsicht bewahrheitet, oder doch lieber Mariannes emotional überladene Spinnereien, aber nein, meistens passierte das, was Sabine aus ihrer konservativen Grundhaltung heraus vorhersagte. So sei die kapitalistische Welt eben, kommentierte sie den Lauf der Dinge, wenn ich mal wieder Anlass hatte, ein enttäuschtes Gesicht zu machen. Auch ihre Einschätzung Achims stimmte, wie sich umgehend zeigte. Einige Woche nach dem gemeinsamen Ausmalen brachte Marianne Achim zu mir. Wir setzten uns an den Computer, diskutierten dort drei Tage lang die Irrungen und Wirrungen, die der Taxifahrer im Drehbuchentwurf über sich ergehen lassen müsste, einigten uns trotz schlagkräftiger Gegenargumente für den Vulkanausbruch mit Zerstörung Berlins als surreale, aber gewünschte Handlungskomponente, schrieben das alles sorgsam in ausgefeilten Formulierungen nieder und gestalteten auch noch ein hübsches Deckblatt, so dass Achim schließlich ein wunderhübsches Exemplar seines Exposés in die Hand gedrückt bekam, damit er es, wie er immer wieder behauptet hatte, bei der Drehbuchförderung einreichen könne.
Als wir ein paar Tage später Marianne verabschiedeten, da ihre Zeit in Berlin abgelaufen war und sie zurück in ihre sächsische Heimat musste, stieß uns Achim ohne jegliches Schamgefühl vor den Kopf. Freudig erklärte er uns, er habe einen neuen Anfang für das Drehbuch. Marianne versuchte sich in Ironie, indem sie meinte, sie hätte schon geahnt, dass Achims Kreativität unsere Vorstellungskraft und erst recht das Format eines Exposés sprengen werde. Außerdem sei es doch unbedingt nötig, so erklärte Achim, dass der Held als Gegenspielerin eine Kontrolleurin aus der U-Bahn bekommen müsse. Davon war nie die Rede gewesen und wir hatten nun die Gewissheit, dass unsere Hilfe nutzlos gewesen war. Achim brauchte weder Drehbuch noch Exposé, er wollte nur darüber reden, aber dafür standen wir nicht mehr zur Verfügung. Marianne sowieso nicht, denn sie wurde von ihrem Vater, als er geschäftlich in der Stadt war, mit dem Auto abgeholt. Ihr Hausrat, den Achim und ich gut kannten, passte problemlos in den großen Kombi. Die Verabschiedung verlief schnell und schlicht, dann fuhr sie zurück in die sächsische Heimat. Der Akkordeonlehrer wollte uns noch zu einem Brokkoli-Auflauf einladen, aber ich fand einen wichtig wirkenden Vorwand, um zu gehen und ließ Achim allein zurück. Brokkoli konnte ich sowieso nicht leiden. In den folgenden Wochen meldete ich mich nicht bei Achim.
Medialismus, Teil 2: Video (analog)
Teil 1 ____ Teil 3____ Teil 4_____ Teil 5
9
Obwohl sie ihre nihilistische Weltanschauung plakativ zur Schau trug, war Tina fast immer gut gelaunt. Oft genug nutzte ich das aus. Wenn ich selbst Aufmunterung brauchte, schilderte ich ihr ausgiebig mein Leid an der Welt und ließ mich bevorzugt dann blicken, wenn mir andere, vermeintlich begehrenswertere Frauen die kalte Schulter zeigten. Dass auch Tina mit einigen persönlichen Problemen kämpfte, die ihr das Leben schwer machten, ignorierte ich meist einfach. „Was ich nicht bemerke, gibt es nicht!“ war einer der coolen Sprüche, die Martin in der „Rückbesinnung“ so schön arrogant aussprach. Eine Textzeile, die ich mir zwar ausgedacht, aber nicht ausgesprochen hatte, schon gar nicht mit dieser Überheblichkeit. Nichtsdestotrotz hatte ich meinen Weg gefunden, diesem Satz Gehör zu verschaffen, hatte den Schauspieler zum Sprachrohr und den Film zum Medium gemacht, mich dadurch der Verbindlichkeit sozialer Umgangsformen und der Höflichkeit entbunden und dann die banale Aussage getroffen, dass ich mich für die Probleme anderer Leute wenig interessierte. Für die Probleme Einzelner. Aber als sozial verbindendes Element sind Probleme sehr interessant und schienen mir außerordentlich wichtig als künstlerisches Motiv. Damit bekannte ich mich quasi zu meiner eigenen Gefühlskälte und bedauerte gleichzeitig die Gefühlskälte als gesellschaftliches Phänomen. So stand ich viel besser da, als wenn ich einfach Mitgefühl praktiziert hätte. Dieser Strategie bedienten sich auch andere Menschen, die Methode fiel mir bei Künstlern, Politikern oder Talkshowgästen oft genug auf.
Aber Tina gegenüber konnte ich mich nicht rauswinden. Ich war blauäugig und spontan bei ihr eingezogen und entgegen meiner Erwartungen war sie ausgesprochen schwermütig. Kein Wunder, sie hatte gerade ihr Studium hingeschmissen, oder vielmehr war sie geschmissen worden, weil sie das Chemie-Vordiplom zum dritten Mal nicht bestanden hatte. Ihr Freund, von dem sie dachte, dass sie es mit ihm länger aushalten könnte als mit seinen Vorgängern, war mit einer dummen Tussi durchgebrannt. Die dumme Tussi sah allerdings ziemlich gut aus und war gar nicht dumm. Das wusste ich, weil ich auch schon mal versucht hatte, sie näher kennenzulernen, doch es war bei einigen anregenden Gesprächen geblieben. Aber das verschwieg ich gegenüber Tina. Wir waren ja inzwischen auf einem anderen Planeten. Wir saßen in diesem kleinen Bauernhof in einem kleinen Dorf, 100 Kilometer von unserer Universitätsstadt entfernt, aber nur 15 Minuten mit dem Fahrrad in die Kleinstadt, in der sowohl Tina als auch ich zur Schule gegangen waren und wo meine Eltern wohnten. Tinas Eltern waren ein paar Jahre zuvor in die Landeshauptstadt gezogen, wo Tina nie hinwollte. Der Bauernhof, den wir immer nur altmodisch als „das Gehöft“ bezeichneten, gehörte früher ihrem Opa, einem Kleinbauern, der längst aufgegeben hatte, aber das Haus war in Schuss, der Opa tot. Die Erbengemeinschaft aus Onkeln und Tanten fand keinen Käufer, deshalb waren sie froh, dass Tina für eine symbolische Miete die Bude bewachte. Man hätte problemlos zu fünft oder sechst dort wohnen können, aber wir waren die ersten und einzigen, die sich das zutrauten. Oder lag es daran, dass wir uns NICHTS zutrauten? Das Ingenieurstudium hatte mir keineswegs das Gefühl vermittelt, irgendeine Art von Kompetenz erworben zu haben, Tina war sowieso frustriert. Trotzdem redeten wir immer davon, dass wir auf unserem Gehöft das Abenteuer suchten, das Wagnis der Abgeschiedenheit eingehen wollten, die spannende Erfahrung der Selbstfindung beginnen würden. Manchmal formulierten wir es ironisch, manchmal ernst, aber wir gaben nie zu, dass man es auch als Rückzug oder Verzagtheit interpretieren konnte. Vielleicht waren wir uns dessen gar nicht bewusst. Vielleicht verdrängten wir es geschickt durch unsere Kulturambitionen.
Schon am ersten Abend, als ich Tina besuchte, um mir das Gehöft mal anzusehen, stolperte ich beim Eintreten über einen Gitarrenkoffer, der zu Hans gehörte, der trotz seiner langen Zottelhaare von sich behauptete, früher Punk gewesen zu sein und jetzt eine Band gegründet hatte, mit der er unbedingt in der Scheune auftreten wollte. Wenn ich dann auch noch ein Video von diesem Auftritt aufnehmen würde, dann sei das eine wundersame Fügung, wie wir alle so zwanglos zueinander gefunden hätten. Wir gingen in die Scheune, wo der Gitarrist ins Gebälk kletterte und uns von oben ein Lied vorspielte, während wir die alten Fahrräder, Zinkbadewannen, Ölkanister und den sonstigen angesammelten Sperrmüll des Großvaters untersuchten. Der Gitarrist sang davon, wie wir die Welt besser und friedlicher machen könnten, während wir rätselten, ob die Waschmaschine, die von dem sonstigen Kram fast vollständig bedeckt war, noch funktionieren würde. Die Zeit sei jetzt reif, wir bräuchten neue Ziele. Hatte das Bob Dylan nicht 25 Jahre vorher auch schon mal so ähnlich formuliert? Das dialektbehaftete deutsche Gesinge in der Scheune erschien mir zunächst unbeholfen, aber als ich den Kopf in den Nacken legte und den Gitarristen über mir auf dem Balken sitzen sah, da erregte es mich und ich fand es plötzlich beeindruckend. Dieser einfache Klang der akustischen Gitarre und vermeintlich tiefsinnige Wortkombinationen aus bedeutungsschwangeren Begriffen wie Zeit, Ende, Frieden und Veränderung jagten mir einen Schauer über den Rücken. Ich war nahe dran zu weinen, mir schien, als sei gerade wirklich ein bedeutender Moment. Vielleicht war es nur der emotional sehr wirksame Wechsel zwischen C-Dur und A-Moll, der mich so beeindruckte? Oder der Blick von unten auf das kräftige Profil der Wanderstiefel des Gitarristen? Die Wanderstiefel weckten in mir Assoziationen an den sprichwörtlichen langen Marsch bis zum Erreichen einer schönen neuen Welt und es versetzte mich in eine Mischung aus Melancholie und Optimismus. Wider besseren Wissens durchströmte mich die Idee, dass Künstler soziale Partisanen seien, die die Gesellschaft voranbringen und den Anstoß zu Erneuerung geben könnten, speziell, wenn sie Schuhwerk mit ordentlichen Sohlen trugen. Vermutlich war es meine spießbürgerliche Erziehung, die mir unterbewusst einflüsterte: Wer etwas erreichen will muss hart arbeiten, und zum harten arbeiten braucht man feste Schuhe. Dabei ließe sich der Kapitalismus vielleicht viel besser bekämpfen, wenn man nichts tat, Leistungsverweigerung, Konsumverzicht, Rückzug aufs Land, Beschränkung auf selbstbestimmte Arbeitsverhältnisse. Tina hatte die Waschmaschine inzwischen so weit untersucht, dass sie mir unbedingt zeigen wollte, warum sie nicht funktionieren könne und riss mich dadurch aus meiner ausschweifenden Betrachtung der Wanderstiefelschuhsohlen. Abgerissene Schläuche, ein fehlender Motor, da gab es keinen Grund zu zögern, ich musste Tina sofort helfen, die Maschine raus zu schleppen, damit sie der Entrümpelung zugeführt werden könnte. Gitarren-Hans verhedderte sich unterdessen in seinen Akkorden und brach das Lied mitten in einer der vielen Strophen ab.
10
Als ich zwei Wochen später mit dem Auto meiner Eltern auf den Hof fahren wollte, stand die Waschmaschine noch an genau derselben Stelle. Dabei hatte Tina bei meiner Abfahrt euphorisch davon geredet, dass sie den ganzen Müll sofort wegbringen wolle, damit wir möglichst umgehend die Umgestaltung der Scheune zum Kulturzentrum beginnen könnten. Die Motivation war offensichtlich ganz schnell in Depression umgeschlagen. Inwieweit der Gitarrist mit den schweren Wanderstiefeln zu ihrer schlechten Laune beigetragen hatte, verriet sie mir erst im Lauf des Abends unter dem fortschreitenden Einfluss von Alkohol und THC.
Der gleiche Alkohol sorgte allerdings auch dafür, dass ich mir das meiste, was sie über Hans erzählte, nicht merken konnte. Dabei ging es gar nicht um die Verletzung ihrer weiblichen Gefühle, zumindest nicht primär, sondern um eine Schallplatte, die Tina sehr am Herzen lag, und Hans hätte sie zu entwenden beabsichtigt, was er als Ausleihen bezeichnete, und er konnte zudem nicht erklären, wieso ein entfernter Bekannter von Tina den Eindruck gehabt habe, Hans wolle ihm genau diese Schallplatte zum Sammlerpreis verkaufen, was der Bekannte Tina umgehend mitgeteilt und somit einen emotionalen Erdrutsch verursacht hatte, der letztendlich dazu führte, dass die Waschmaschine trotz bester Vorsätze immer noch die Hofeinfahrt blockierte.
Deshalb schob ich erst die Waschmaschine zur Seite und versuchte dann das gleiche mit Tinas Sorgen. Und wenn ich da nicht vorankam, weil mir nichts Lustiges einfiel oder es mir an Einfühlungsvermögen mangelte, schob ich wieder das Gerümpel hin und her. Zunächst dachte ich, das geht ganz schnell, man muss nur richtig zupacken, aber dann war es ein schier endloser Prozess des Hin- und Hersortierens, schließlich auch des Diskutierens, denn Tina wollte ein Wörtchen mitreden, was wegzuwerfen sei und was nicht. Als ich dann auf die Idee kam, wir könnten die absonderlichsten Dinge mit den letzten verbliebenen Rollen Schwarzweiß-Film verewigen, sorgte dies für eine weitere Verlangsamung. Aber damit war der leidige Prozess des Aufräumens zu einem kreativen Prozess geworden. Es ging nicht mehr darum, schnell fertig zu werden, sondern um die Dinge, die wir in der Scheune fanden. Nach den Monaten der Anspannung, die mir meine Diplomarbeit beschert hatte, gefiel mir das besser als zunächst erwartet. Natürlich sollte die Premiere des „Filmes über die vergessenen Dinge“ gleichzeitig die Eröffnung unseres Scheunen-Kinos, Kulturzentrums, alternativen Lebensraumes sein. Bis dahin, so beschlossen wir bei einer unserer unzähligen Kaffeepausen, wollten wir uns nicht hetzen lassen, deklarierten die Zeit als Sommerferien und nahmen uns vor, alles andere auf uns zukommen zu lassen.
Es ergab sich, dass immer etwas passierte: Diverse alte Freunde aus Schulzeiten besuchten uns auf dem Land und beteuerten stets, wie idyllisch es sei. Unterdessen durchforstete ich all meine unvollendeten Drehbücher, um Auszüge aus ihnen zu einer Lesung zusammenzustellen, die mit den allerbesten meiner Filme kombiniert werden sollten. Ein paar Abstecher an die Universität waren auch noch nötig, damit man mir irgendwann das Diplom-Zeugnis tatsächlich ausstellte und als ich es endlich hatte, kopierte ich es stapelweise, um einige lustlose Bewerbungen zu schreiben. Tina hatte sich unterdessen einen gebrauchten Synthesizer gekauft, oder geschenkt bekommen, denn es war einer von den monophonen Geräten, die zu dem Zeitpunkt total out waren. Zwar beschäftigte sie sich eifrig damit, wie sie knatternde und zischende Geräusche erzeugen konnte, aber solange sie nicht in einer Band mitspielen würde, war fraglich, was sie damit anfangen könnte, außer Special-Effects-Sounds für meine Filme. Viel Zeit investierte sie in die Wohnraumgestaltung und Renovierung unseres Häuschens. Als sie schließlich auch noch begann, in einer der beiden Szene-Kneipen, die es in der Umgebung gab, als Bedienung zu arbeiten, war ihre Zeit gut ausgefüllt. Für mich war das sehr praktisch, denn ich ging zuerst in die andere Kneipe. Wenn ich dort jemanden zum Unterhalten fand, blieb ich, wenn nicht, was meistens der Fall war, machte ich mich auf zu Tina, der ich erst einmal Bericht erstattete, dass bei der Konkurrenz nichts los sei und dann hatte ich wieder die Auswahl, entweder einen der Gäste vollzuquatschen, oder mich mit Tina zu unterhalten. Bei einem dieser vielen Kneipenbesuche traf ich Gitarren-Hans wieder, der immer noch von einem Video für seine Musik redete und mir einen Kontakt zu einem Jugendzentrum in der nächsten Provinzstadt vermittelte. Dort könnte ich ein kleines Videostudio betreuen. Wenn ich den Jugendlichen, für die das Jugendzentrum vorgesehen war, beibringen würde, wie sie mit der Technik umzugehen hatten, könnte ich dafür etwas Geld bekommen, und das kam mir gerade recht. Die Ersparnisse für die Zeit nach der Diplomarbeit gingen gerade zur Neige und wären schon erschöpft gewesen, wenn ich nicht so billig auf Tinas Gehöft wohnen und bei ihr an der Theke hätte trinken können. Die Chefs vom Jugendzentrum hatten alle keine Ahnung von Video, aber durch irgendwelche Fördergelder war ein kleines Studio eingerichtet worden, das inzwischen weitgehend unbenutzt verstaubte. Die Röhrenkameras, die damals in der Studiotechnik gebräuchlich waren und von denen auch dort ein veraltetes Modell herumstand, empfand ich zwar als eine besonders umständliche Technik-Missbildung, aber in Verbindung mit dem Schnittplatz hatte ich nun ein Experimentierfeld für die Technik, über die ich oft genug abfällig geredet hatte. Videomischer und Videoeffektgeräte kannte ich von einem ähnlichen Studio in der Universität, wusste so ungefähr, was die spärliche Beschriftung an den vielen Knöpfen bedeuten sollte und jetzt konnte ich es genauer ausprobieren.
Hans spielte Gitarre und sang eines seiner Weltverbesserungslieder, während ich zwei Kameras auf ihn richtete und die dritte auf den Programm-Monitor. Ich färbte die Kamerabilder farbig ein und mischte sie im Rhythmus der Musik mit dem Ausgabebild, was pulsierende Schauer von Video-Rückkopplungen ergab. Damit konnte ich Hans beeindrucken, weil, wie er meinte, seine Gitarrensaiten durch die Videorückkopplung sich der Unendlichkeit zu nähern schienen. Ich sagte, dass das nur banale elektronische Effekte waren, er bezichtigte mich des Understatements. Leider hatten wir keine guten Mikrofone da, deshalb verschoben wir die Aufnahme des Videos, außerdem wollte Hans am Text seines Liedes etwas ändern.
Zwischendurch, eine oder zwei Wochen später, schleppte er eine Sängerin an, die nach eigener Aussage gar nicht singen konnte oder wollte, aber Hans war der Meinung, sie sei genau die Richtige, um seine Lieder im Video zu unterstützen. Vermutlich sollte sie einfach gut aussehen und unser Videostudio bestaunen. Aber sie kannte so etwas schon, erzählte mir, dass ihr Freund Grafik-Design studiert hatte und an der Grafik-Design-Hochschule gab es ebenfalls ein Videostudio. Ihr Freund mit Namen Ulrich behauptete, wenn ich das Jugendzentrumsvideostudio richtig verstanden hätte, dann genüge das, um beim Lokalfernsehen Ober-Techniker, Studio-Leiter, Chef-Cutter oder EB-Kameramann zu werden. Natürlich zu einer Bezahlung, die den hochtrabend bezeichneten Aufgaben nicht gerecht werde. Was für ein Lokalsender, fragte ich unschuldig, denn ich kannte nur das Regionalbüro des öffentlich-rechtlichen Programms, von wo man gelegentlich einen bärtigen dicken Kameramann zu den herausragenden Ereignissen der Provinz schickte. Weil es hieß, die öffentlich-rechtlichen Sender akzeptierten nur Kameramänner, die fünf Jahre an der Filmhochschule studiert hätten, damit sie ausreichend qualifiziert seien, um einen Maßkrug und die dazugehörige Blaskapelle für die Abendschau zu filmen, wollte ich mit denen nichts zu tun haben. Mich hätten die nur als stellvertretenden Hilfskabelträger genommen, aber beim Lokalfernsehen, da könne man Quereinsteiger wie mich brauchen, sagte Ulrich zu seiner Freundin, und die Freundin zu mir.
Hans und Tina wiederum stellten mir unabhängig voneinander die Frage, was ich dort wolle, bei der Kommerzscheiße und ob ich schon mal den Käse auf RTL und SAT 1 angeschaut hätte. Nein, das hatte ich nicht, ich wollte es auch nicht und die beiden mussten zugeben, dass ihnen selbst bisher auch die persönliche Grenzwerterfahrung fehlte, einen analytischen Blick auf das damals noch junge, sogenannte Privatfernsehen geworfen zu haben. Trotzdem waren sie davon überzeugt: Das ist Mist! Ich widersprach nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ungeachtet der ungeklärten moralisch-ideologischen Einordnung des Phänomens Lokalfernsehen besuchte ich Ulrich eines Abends im Kontrollraum des Aufnahmestudios und dann ging alles ziemlich schnell. Ein paar Tage später stellte ich mich beim Chef vor, einem selbstgefälligen Typen, der meinte, er würde schon merken, ob man mit mir was anfangen könne und am darauffolgenden Montag ging es los, und zwar als Assistent im Praktikantenstatus.
11
Als Kameraassistent musste ich mir den Rekorder über die Schulter hängen. Die Technologie nannte sich U-Matic und war nur von bescheidener Qualität, durfte sich trotzdem als professionell bezeichnen. Um ein Video zu schneiden, wird es kopiert. Während der chemische Film mit der Schere auseinandergenommen und mit Klebefolie neu zusammengefügt wird, kopiert man beim Videoschnitt die gewünschten Aufnahmen auf ein weiteres Videoband. Allerdings wird die Qualität von U-Matic-Aufnahmen bei jedem Kopiervorgang schlechter. Im Jugendzentrum wurde mit VHS gearbeitet, das war noch schlimmer, denn VHS bedeutet Video Home System: Eine Amateurtechnologie.
An der Uni hatte ich das ominöse U-Matic-Videoformat mit den riesigen Kassetten schon kennengelernt, aber nur darüber gelästert, weil ich ja zum anderen Lager gehörte, zu den Super-8-Ästheten. Jetzt, da das Studium zu Ende war, verlor dieser willkürliche Kultur-Stellungskrieg für mich an Bedeutung, jetzt ging es darum, meine bescheidenen Erfahrungen irgendwie in klingende Münze zu verwandeln und dazu musste ich zunächst dem Kameramann an einer kurzen Leine hinterherlaufen. Die Leine war das Verbindungskabel zwischen der Kamera und dem Aufnahmegerät und beide, die Kamera und der Rekorder waren klobige, schwere Geräte mit riesigen Akkus, die sich im Nu entleerten.
Weil in der Kamera Röhren zur Bildwandlung verbaut waren und Röhren sowohl träge als auch empfindlich sind, musste man höllisch aufpassen. Filmte man eine Lichtquelle, dann verursachte dies in der Röhre ein Signal, das nur langsam wieder verschwand, was bei bewegten Lichtquellen zu einem Schweif führte. Den nannte man „Nachzieher“. Starke Lichtquellen, die zu lange auf die gleiche Stelle des Bildes leuchteten, erzeugten einen bleibenden Fleck, was wiederum als „Einbrenner“ bezeichnet wurde. Direkte Sonneneinstrahlung konnte sogar dazu führen, dass die Aufnahmeröhre ganz schnell total ruiniert wurde, deshalb durfte man die Sonne auf keinen Fall ins Bild nehmen.
Elektronenröhren können verschiedene Funktionen erfüllen. Die wichtigste Funktion der Elektronenröhren, einen starken Strom durch einen schwachen Strom zu regeln, hatten zu der Zeit längst Transistoren übernommen. Auch andere Funktionen, wie beispielsweise die Bildwandlung, also die Umsetzung eines optischen Bildes in ein elektronisches Signal, wurden im Zug der technischen Fortentwicklung von der Halbleitertechnologie übernommen. Leider zu spät für mich, so dass ich noch mit den letzten Röhrenkameras und den dazugehörigen Umhängerekordern von einem unbedeutenden Ereignis zum nächsten geschickt wurde, immer in zwei Meter Kabellänge hinter dem coolen Kameramann, der gemeinsam mit Ulrich direkt von seinem Grafik-Design-Studium zum Lokalfernsehen gewechselt war und stets eine ironische Bemerkung zu den Motiven unserer Bildaufnahme machen konnte.
Sobald wir den Ort des Geschehens verließen und im Auto saßen, rissen wir Witze über die Leute, die wir gefilmt hatten. Oder über unsere Kameras, über den klapprigen Kleinbus, über unser idyllisches Provinzstädtchen. Im Gegensatz zum coolen Kameramann gab es auch den uncoolen Kameramann, einen verklemmten Pedanten, der einerseits den sportlichen Dienstwagen mit den Ledersitzen fuhr und mir andererseits jeden seiner klugscheißerischen Ratschläge mindestens fünf Mal gab: Verbindungskabel nicht spannen lassen, Schatten spenden, Linsendeckel aufsetzen und all diese langweiligen Anweisungen, die ihm einfielen, um mir zu demonstrieren, wie wichtig er das alles nahm. Mit ihm hätte ich den Job nicht lange durchgehalten, aber kaum war ich einen Monat dabei, konnten wir die Früchte der unermüdlichen Forschungsbestrebungen der japanischen Elektronikindustrie ernten. Die nächste Generation von Aufnahmetechnologie wurde geliefert. Schluss mit den Bildröhren und Schluss mit den Umhängerekordern, plötzlich gab es in unserem kleinen Lokalfernsehen riesige Super-VHS-Camcorder mit CCD-Chips. Halbleitertechnologie erlöste uns von der Problematik der Einbrenner und Nachzieher. Da man nun keinen Rekorderträger mehr brauchte, konnte ich als Kameramann eingesetzt werden.
Natürlich ging es mit einem Dreh los, den niemand machen wollte. Es war nach der täglichen Sendung, alle waren in Nach-Hause-Geh-Laune, da kam der Redakteur mit einem Fax in der Hand durch den Flur gelaufen und fragte, wer die Ikonenausstellungseröffnung filmen würde. Welche Ikonenausstellung? fragten der coole und der uncoole Kameramann im gleichen geringschätzigen Tonfall und ich sagte gar nichts. Die wichtige Ikonenausstellungseröffnung, erklärte der Redakteur mit starker Betonung auf dem Wort „wichtig“, weil am nächsten Tag die Ikonenexpertin Studiogast sein solle und jetzt würde unser wichtiger Bürgermeister mit wichtigen Gästen aus der russischen Partnerstadt die wichtige Ausstellung eröffnen.
Die unglaubliche Wichtigkeit beeindruckte weder den coolen noch den uncoolen Kameramann und so kam ich zu meinem ersten Einsatz als sogenannter EB-Kameramann. EB bedeutet elektronische Bildberichterstattung. Aber richtig wichtig kommt man sich vor, wenn man die Bezeichnung ENG-Kameramann benutzt, das bedeutet „electronic news gathering“. Ich schnappte mir also die Kamera und bekam als Begleitung die neue Praktikantin mit, die war erst seit drei Tagen dabei und deshalb hatte sie noch weniger Erfahrung als ich. Für sie war es ebenfalls der erste selbstständige Einsatz als Reporterin vor Ort. Das hielt ich für eine gute Voraussetzung, da würde sie mir keine dummen Vorschläge machen, was ich zu filmen hatte und hübsch war sie auch. Ob sie sich mit Ikonen auskenne, fragte ich und sie gab zu, dass sie von nichts eine Ahnung hätte und am allerwenigsten von Ikonen.
Das sind die besten Voraussetzungen, meinte ich, somit sei sie genauso uninformiert, wie der durchschnittliche Zuschauer und würde die richtigen Fragen stellen. Ansonsten, schlug ich vor, filmen wir ein paar Ikonen, wie es sich für eine Ikonenaustellungseröffnung gehört und, sofern vorhanden, ein paar russische Charakterköpfe, außerdem Funktionäre, die es ja in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gibt. Ich war erfolgreich großspurig, die Praktikantin bemerkte gar nicht, dass ich nur ein paar Wochen vor ihr als Rekorderträger angefangen hatte. Jetzt war ich im ENG-Einsatz und hatte ganz schön mit den Reflektionen zu kämpfen, die das viele Gold der Ikonen im Licht der Scheinwerfer verursachte. Aber mein häufiges Hin- und Herrücken der Kamera, das sorgfältige Justieren und meine kritische Miene sorgten vermutlich dafür, dass ich sehr professionell wirkte. Ich gab mir Mühe, hübsche Nahaufnahmen hinzukriegen, sowohl von den Ikonen, als auch von den zahlreich, gutaussehenden Kultur-Hausfrauen. Außerdem gelang mir trotz der ungünstigen Raumaufteilung eine gelungene Totale, bei der im Vordergrund die Kunstexperten der russischen Delegation mit dem Bürgermeister plauderten. Nach einer halben Stunde waren die notwendigen Aufnahmen erledigt und wir konnten uns ausgiebig dem Wein und den Brezeln zuwenden. Die Pressesprecherin der Genossenschaft, in deren Foyer die Ausstellung gezeigt wurde, kümmerte sich liebevoll um unsere Versorgung. Unaufdringlich brachte sie für Interviews einen Fachmann und einen Funktionär zu uns, wobei Letzterer vermutlich ihr Chef war. Es störte niemanden, dass wir keinerlei kunsthistorisches Hintergrundwissen vorweisen konnten und das fand ich damals sehr entgegenkommend. Später machte ich die Erfahrung, dass es durchaus normal war, wenn Fernsehreporter keine Ahnung von der Thematik haben. Die Praktikantin stellte bei den Interviews mit charmantem Lächeln naive Fragen. Sowohl der Fachmann, als auch der Funktionär gaben brauchbare Antworten. Als wir fertig waren, legte ich ihr zur Anerkennung die Hand auf die Schulter und sagte, dass sie es gut gemacht hätte. Das freute sie und während ich die Kamera wegpackte, besorgte sie schon wieder gefüllte Weingläser. Ich merkte, wie mir der Alkohol in den Kopf stieg und genoss es. Der Tag war lang gewesen, zu essen hatte ich nicht viel bekommen. Die Praktikantin fragte mich, wo ich es gelernt hätte, mit der Kamera umzugehen, und sie stellte die Frage mit dem Unterton der Bewunderung. Sie dachte bestimmt, ich mache das seit Jahren und nicht zum ersten Mal. Trotzdem wusste ich selbst nicht, wo ich mein Wissen her hatte, überall und nirgends, vielleicht lernt man auch beim Lästern.
Ich erzählte ihr, dass mein Spezialgebiet eigentlich die Super-8-Schwarzweißfilmerei sei, aber diesen umständlichen Videokameramonstern, die wir zum Fernsehmachen benutzen, könne man ja kaum aus dem Weg gehen, überall hätten sie sich verbreitet und da spreche es sich eben rum, welcher Knopf welchen Zweck erfülle. Der coole Kameramann hatte mir einiges gezeigt, was ich ansatzweise auch schon bei den Kameras im Universitätsstudio kennengelernt hatte, während mich der uncoole Kameramann in die speziellen Geheimnisse der Technologie einführte. Das machte er aber nur, weil er merkte, dass ich schon Erfahrung hatte und deshalb wollte er mir zeigen, wie weit er mir voraus war. Er, der pedantische Perfektionist, kannte auch die internen Menüs und die verborgenen Knöpfe. Das war hilfreich für mich. Ich hatte sowohl beim coolen, als auch beim uncoolen Kameramann die richtige Haltung gefunden, damit sie mich an ihrem Wissen teilhaben ließen. Man durfte sich nicht zu doof anstellen, aber auch nicht den Schlaumeier raushängen lassen. Gegenüber der Praktikantin tat ich so, als sei mir das Fachwissen einfach zugeflogen und bevor sie nachfragen konnte, wollte ich von ihr wissen, wie sie zum Lokalfernsehen gekommen sei. Sie hieß Maria, ihr Germanistikstudium erschien ihr ausgesprochen nutzlos und zum Praktikum sei sie nur gegangen, weil sie die jungen, unangepassten Moderatorinnen von MTV bewunderte. Sowas würde sie ja auch gerne machen. Ob ich schon Musikvideos gedreht hätte? Alles, bloß das nicht, dachte ich, doch da fiel mir Gitarren-Hans ein, der immer noch auf den geeigneten Termin für eine Aufnahmesession wartete. Das würde zwar kein typisches Musikvideo werden, schon gar keins für MTV, sondern eher ein Kunstprodukt, aber um Maria zu beeindrucken, tat ich so, als stünden die Dreharbeiten unmittelbar bevor und sie sagte, sie wolle unbedingt dabei sein. „Unbedingt dabei sein wollen“ war eine Formulierung, die mich misstrauisch machte und aufschreckte. In der Vergangenheit hatten das immer diejenigen gesagt, die dann doch keine Zeit hatten. Ich bemerkte, wie betrunken ich schon war und wenn ich an Maria vorbei in die Ikonen schaute, drehte sich deren goldener Schimmer. Wir mussten dringend weg, doch da gab es keine Alternative zu unserem klapprigen Kleinbus, mit dem wir gekommen waren. Ich sollte die Kamera noch im Studio abliefern und das Auto durfte ich danach benutzen, um nach Hause zu fahren, da abends die Verbindung in die Dörfer mit Bus und Bahn noch länger als tagsüber dauerte.
Maria war genauso wenig fahrtauglich wie ich, aber im Kleinbus wollte sie sowieso nicht ans Steuer. Ansonsten schien sie keine Bedenken zu haben, was die Vereinbarkeit von Alkoholgenuss und motorisierten Straßenverkehr anging. Zum Glück war es draußen ziemlich kühl, eine sternklare Nacht, das machte mich munter und ich konnte mich halbwegs konzentrieren, den Kleinbus durch die weitgehend leeren Straßen zu lenken. Maria stellte das Radio an und es dudelte einer der vielen Sommerhits, Mainstreamradio. Sie fand das gut, ich gar nicht, sie drehte die Lautstärke auf, ich kurbelte das Fenster zu. Bloß nicht auffallen! Den Führerschein bei der Fahrt mit dem Dienstwagen abzugeben, wäre ein sehr peinlicher Zwischenfall gewesen. Trotzdem wollte ich entspannt erscheinen und ersparte mir, gegen die laute Musik zu protestieren. Maria begann Tanzbewegungen auf dem Beifahrersitz zu vollführen, Gutelaunegestik, die mich nervte und sie schubste mich an die Schulter, meinte, ich solle nicht die trübe Tasse spielen, aber ich knurrte nur.
Dann fuhren wir unbehelligt an der Polizeihauptwache vorbei, wo trotz meiner Befürchtungen niemand auf uns wartete und bogen in die Straße längs des Flusses ein. Bis zum Studio ging es nur noch geradeaus, das beruhigte mich. Da traute ich mich, ein bisschen Konversation zu riskieren und fragte, wo Maria wohne, und wie sie nach Hause kommen wolle. Sie würde ja gerne noch etwas Trinken gehen, meinte sie, aber wo? Erstmal Kamera abladen, antwortete ich, während ich in die Tiefgarage einbog, in der sich der Stellplatz für den Kleinbus befand. Jetzt war ich erst einmal in Sicherheit.
Mit dem Auto aufs Dorf fahren ging in meinem Zustand auf keinen Fall, doch wo sollte ich dann die Nacht verbringen? Maria wohnte in der Stadt, da konnte sie zur Not laufen oder Taxi fahren. Sie am ersten Abend zu fragen, ob ich zu ihr mitkommen könne, wäre allzu verfrüht, zumal ihre ungehemmte Partylaune in mir den Verdacht weckte, sie könne ein sehr oberflächlicher Mensch ohne den intellektuellen Hang zur Selbstreflektion und Systemkritik sein, den ich stillschweigend für potentielle Sexualpartnerinnen voraussetzte. Dass mir tatsächlich solche Worte im Kopf herumschwirrten, während wir im Lastenaufzug mit der Kamera von der Tiefgarage nach oben fuhren, glaube ich kaum. Aber es war die entsprechende Mischung aus Misstrauen und Sympathie. Maria spulte unterdessen eine Liste aller Kneipen, Bars und Diskotheken ab, die für uns in Frage kämen, um den Abend fortzusetzen und ihre Bewertung der jeweiligen Lokalitäten entpuppte sich als sehr gegensätzlich zu meiner Einschätzung. Was sie als gemütlich bezeichnete, empfand ich als spießig, den Laden, in dem angeblich die angesagtesten Leute verkehrten, hielt ich für einen Treffpunkt von aufgeblasenen Angebern und als ich vorschlug, in das von mir bevorzugte Alternativcafé zu gehen, da spottete sie tatsächlich, dass dort doch nur Systemkritiker säßen, die in Selbstreflexion versänken.
Über diese vorlaute Antwort staunte ich erst einmal, musste dann lachen und fühlte mich gleichzeitig ertappt. Die Worte Systemkritik und Selbstreflexion brannten sich für immer in meine Erinnerung an diesen Abend ein. Gleichzeitig verloren beide Begriffe an Bedeutung und an Wert.
12
Oben im Studio saß tatsächlich noch Ulrich, mit dem ich mich gleich angefreundet hatte und der ein Auge darauf warf, ob bei mir alles klappte. Schließlich hatte er es eingefädelt, dass ich mich beim Chef vorstellen konnte. Jetzt schnitt er an einem Werbefilm herum. Tagsüber hatte er für so etwas keine Zeit, da mussten die tagesaktuellen Berichte für die Sendung geschnitten werden. Es war gegen zehn Uhr abends, aber mir kam es vor wie nach Mitternacht. Wir schauten gemeinsam in mein Videomaterial und konnten feststellen, dass alles ordnungsgemäß aufgenommen worden war, was mich erleichterte und ermunterte, ein paar Witze über die Ikonenausstellung und die Ikonenausstellungsbesucher zu reißen. Dann wurde wieder die Frage aufgeworfen, ob und wo wir noch was trinken könnten, ob Ulrich mitkäme, oder ob ich lieber gleich in mein Dorf fahren solle. Schließlich schmiss mir Ulrich seinen Haustürschlüssel hin und meinte, er müsse den Werbefilm fertigschneiden, das brauche noch eine Stunde oder mehr und danach würde er sowieso zu seiner Freundin gehen, um bei ihr zu übernachten. Ich solle auf jeden Fall das Auto stehen lassen, vor allem wenn wir in die Bar gingen, die Maria vorschlug, da in der Gegend ständig Verkehrskontrollen stattfinden würden. Ulrich gebärdete sich ein wenig so, als sei er mein großer Bruder, das war gut, das war sogar sehr gut.
Nachdem ich meine Abfuhr wegen der existentialistischen Stimmung in meinem Lieblingscafé schon weg hatte, wehrte ich mich nicht, als Maria mich mit in die von ihr angepriesene Angeberbar mitnahm. Ich genoss den Ausblick auf die vielen gutaussehenden Frauen und unterhielt mich mit Maria auf angenehme Weise über ausnahmslos banale Themen. Nach zwei Bier wurde ich von einer großen Müdigkeit übermannt, die zweifellos damit zusammenhing, dass Maria sich plötzlich in ein Gespräch mit einem jungen, ziemlich geschniegelten Typen vertiefte, den sie mir schließlich als ihren Freund vorstellte. Ich hatte gar nicht bemerkt, wann der aufgekreuzt war. Da es damals keine Handys gab und Maria auch keine Telefonzelle benutzt hatte, schien es eine Verabredung zu sein, und damit entpuppte sich Marias lange Überlegung, wo wir hingehen könnten, als Augenwischerei. Das enttäuschte mich und weil es wegen der ansteigenden Lautstärke immer schwieriger wurde, sich zu unterhalten, verabschiedete ich mich, wankte mit wirren Gedanken, die um Systemkritik und Selbstreflexion kreisten, zu Ulrichs Wohnung. Ein paar Tage vorher hatte ich ihn mit unserem klapprigen Kleinbus vor seiner Haustür abgesetzt, deshalb kannte ich seine Adresse. In seiner Einzimmerwohnung herrschte ein normales Junge-Männer-Durcheinander, da konnte ich mich ganz ungezwungen verhalten. Ich warf einen schnellen Blick auf seine Schallplattensammlung, die, wie erwartet, ähnlich zusammengesetzt war, wie meine eigene. Dann legte ich mich auf sein großes Bett. Mitten in der Nacht erwachte ich, weil ich aufs Klo musste und ich hatte zunächst überhaupt keine Ahnung, wo ich mich befand, stand auf, suchte den Schalter der Stehlampe, schlug dabei mit dem Schienbein an den Tisch. Nach dem Pinkeln ging es mir besser, aber am nächsten Tag fühlte ich mich schlecht und kraftlos. Dabei gab es einiges zu tun. Immerhin waren sowohl der Chef als auch der Redakteur zufrieden mit meinen Ikonen-Videoaufnahmen, was zur Folge hatte, dass ich gleich wieder losgeschickt wurde. Dieses Mal ging es darum, den neuen, supermodernen Müllwagen der städtischen Müllabfuhr zu filmen. Verkatert wie ich war, schien mir Müll ein dankbares Thema, aber die Bilder gelangen mir nach eigener und Ulrichs Einschätzung nur mittelmäßig. Schließlich ging der Arbeitstag damit zu Ende, dass die Ikonenexpertin live im Studio interviewt wurde und mir danach, obwohl ich als Kameramann unauffällig im Halbschatten stand, plötzlich die Hand schüttelte. Das freute mich sehr, machte mich aber auch stutzig. Hatte sich die Ikonenexpertin bei mir bedankt, weil sie wusste, dass die Aufnahmen von der Ausstellung von mir stammten, oder glaubte sie, dass ich sie beim Studiogespräch im Bild hatte, was ja gar nicht stimmte, denn ich machte die Nahaufnahmen des Moderators, während für sie der coole Kameramann zuständig war, aber dem drückte sie nicht die Hand, den schien sie gar nicht zu bemerken. Oder fand sie mich einfach nett? Während ich mir diese Fragen stellte, glitt die Landschaft am Fenster vorbei, denn es war Freitagabend. Mit dem Zug fuhr ich in die Kleinstadt. Das Kreuz eines Kirchturms blitzte in der tiefstehenden Sonne. Waren Ikonenexperten eigentlich, so rein ideologisch und systemtheoretisch gesehen, gute oder schlechte Menschen? Waren sie schädlich und reaktionär wie ein Kirchenfunktionär oder hatte die Ikonenexpertin eine heimliche Leidenschaft für den Kommunismus und betrieb ihre Forschung, um möglichst unauffällig den Kontakt mit der Sowjetunion zu pflegen? Oder vielmehr mit Russland, denn die Sowjetunion gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Vielleicht war sie bei der Stasi oder beim KGB und wenn ich damals in die Zusammenarbeit eingewilligt hätte, wäre sie mein Führungsoffizier geworden. Ich versuchte verzweifelt, diese albernen Gedanken zu verscheuchen, es gelang mir nicht. Meine Blasen schlagende Phantasie, die sich als potentiell mögliche Variante der Wirklichkeit tarnte, ging mir auf die Nerven. Erst als ich am Bahnhof der Kleinstadt ausstieg, wo ich mit dem Fahrrad noch fünfzehn Minuten bis ins Dorf fahren musste, gelang es mir, einen klaren Kopf zu bekommen.
13
Aber kaum war ich zu Hause angelangt, bescherte mir Tina frische Anregungen für den ideologischen Diskurs. Martin hatte angerufen, aus Berlin, er wollte uns eine Woche später besuchen. Wie schön. Er fragte, ob wir eine Filmvorführung des falschen Filmes einplanen könnten, den Film wolle er unbedingt sehen und seine Begleitung auch. Welche Begleitung, fragte ich, Sabine? Tina wusste es nicht, sie wusste nur, dass Martin dann auf dem Rückweg von der „Ars Electronica“ in Östereich wäre, dem wichtigsten Event für elektronische, progressive Kunst weltweit, aber ich würde mich ja nur um dieses banale Lokalfernsehen kümmern. In der Tat, das tat ich, und schon fielen mir die Ikonen wieder ein. Die Ikonen waren Tina egal, sie dachte an die Scheune, wo immer noch ein heilloses Durcheinander herrschte. Meine Filmaufnahmen der vergessenen Gegenstände, die durch den Prozess des Filmens aus dem Vergessen erlöst werden sollten und dadurch in einen ästhetischen und medialen Meta-Sinn überführt werden könnten, waren bisher noch nicht weit fortgeschritten. Die Stirnseite der Scheune, die ich weiß bemalen wollte, damit sie als Projektionsfläche dienen könnte, wartete noch darauf, freigeräumt zu werden. Auch ich wünschte mir, dass unsere künstlerischen Aktivitäten vorangingen, leider kostete das banale Lokalfernsehen nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Kraft, so dass ich am Wochenende erschöpft war. Tina konnte es sich nicht verkneifen, mir eine Diskussion aufzudrängen. Sie wollte mir unbedingt einreden, dass mein kleines Lokalfernsehen im Dienste des großen, weltumspannenden Kapitals die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung zermürben sollte. Ja? Wirklich? Und wie? Weil wir darüber berichteten, dass ein neuer Spielplatz eingerichtet wurde und die Baustelle am Markplatz bis voraussichtlich Oktober zu Verkehrskomplikationen führen würde? Ich hatte die Beispiele gut genug gewählt, diesen Nachrichten konnte Tina keine globale Strategie nachweisen. Zum Glück schaute sie unseren Sender gar nicht an, deshalb gelang ihr keine gute Erwiderung. Ihr blieb nur der relativ harmlose Vorwurf, dass wir die Interessen unserer Sponsoren und Werbekunden sublim an die Zuschauer weiterleiten würden, was ich gut entkräften konnte, denn ich sagte, dass wir das nicht sublim, sondern ganz offensichtlich machen und es sei wirklich höchste Zeit, in der Scheune weiterzuarbeiten, bevor ich mir die billige Bildsprache der ENG-Kameraleute angewöhnen würde. ENG? Fragte Tina und ich antwortete „Electronic News Gathering“, das klingt eigentlich noch sensationeller als „Ars Electronica“. Ist es aber nicht, ist doch nur Angeberei! Anstatt zu antworten, ging ich in die Scheune. Ein blechernes Sieb, eine kurbelbetriebene Handbohrmaschine, zwei Lampenschirme aus einem undefinierbaren Material, Zahnräder, ein Spazierstock mit angeschraubter Fahrradklingel, Isolatoren. Das waren die ausgewählten vergessenen Dinge, die ich auf einen klapprigen Tisch gelegt hatte. Daneben stand ein wackliger alter Holzstuhl. Das war noch keine aufregende Sammlung, deshalb wandte ich mich dem großen Haufen zu, der noch nicht untersucht war. Als ich einen halb vermoderten Teppich rauszog, kam ein alter Fernseher zum Vorschein, ein Sessel und etliche Kartons voller Zeitungen. Die konnte man wenigstens gleich zum Altpapier bringen und musste nicht erst den Sperrmüll abwarten. Tina kam mit einer Flasche Wein, zwei Gläsern und setzte sich auf den Stuhl. Einen zweiten Stuhl fand ich zwischen alten Matratzen. Also stellte ich ihn zum Tisch, schenkte mir ein Glas Wein ein und wir rauchten erst einmal selbstgedrehte Zigaretten. Sie erzählte mir von einem Streit mit ihrer Mutter, und von einer Anfrage des Onkels, der wissen wollte, wie schnell wir ausziehen könnten, wenn jemand das Gehöft kaufen würde. Dabei waren wir mit dem Einziehen noch gar nicht fertig. Aber vermutlich sei das nur blinder Alarm, niemand kaufe diese alte Bude. Es will ja nicht mal jemand drin wohnen, obwohl Tina wieder ein paar Kleinanzeigen aufgehängt hatte: WG-Zimmer auf dem Land zu vergeben. Gestern sei einer dagewesen, ein komischer Vogel, der sich beschwert hätte, dass ich nicht da sei, denn wenn er schon aufs Land fahre, wolle er alle Mitbewohner sehen. Tina hätte ja gar nicht gewusst, warum ich nicht gekommen sei, und es sei unangenehm mit dem Typen gewesen, der dann aber nach einer Stunde aufgab und verschwand, hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. WG zu dritt ist gefährlich, das klappt fast nie, sagte ich, können wir nicht gleich zwei Leute suchen? Die Meisten sind doch sowieso dumme Studenten, die gehen uns dann ganz schnell auf die Nerven, das garantiere ich dir. Seit Tina von der Uni geflogen war, mochte sie keine Studenten mehr, Fernsehleute und das Mediengesindel, wie sie es mir gegenüber provokativ bezeichnete, waren ihr suspekt und wenn Punks oder Arbeitslose kamen, dann beschwerte sie sich, dass die zu nichts zu gebrauchen seien. Die einzigen, die sie kritiklos akzeptierte, waren Künstler. Darum war ich erste Wahl gewesen und hatte ohne Vorbehalte einziehen können. Aber meine blitzschnelle Verwandlung zum Kommerzfernsehkameramann passte ihr gar nicht ins Konzept. Es tröstete sie wenig, als ich beteuerte, nichts vom Kommerz abzubekommen, sondern nur als Praktikant bezahlt werde, und deshalb sei ich darauf angewiesen, diesen alternativen Lebensstil mit ihr im entlegenen Bauernhof zu praktizieren. Ich hatte Tina grundsätzlich enttäuscht, das war klar. Mein Gejammer über die Probleme mit der Diplomarbeit und die Probleme mit dem bürgerlichen Leben und die Probleme mit dem Kapitalismus machte viel von dem aus, was uns verband. Dann war aber eines Tages mein Diplomzeugnis als Einschreiben mit der Post gekommen und ich sagte, ich hänge es aufs Klo. Das machte ich tatsächlich, in einem alten Bilderrahmen, der aus dem Nachlass des Opas stammte. Das sah gut und witzig aus, aber irgendwann bemerkte Tina, dass es nur eine Kopie war. Selbstverständlich! Eine von den Fotokopien, die ich für meine erfolglosen Bewerbungsmappen gezogen hatte und nicht das Original. Womöglich kam einer unserer Gäste auf die Idee, einen schlechten Klospruch draufzukritzeln, oder den Namen seiner Lieblingsband. Tina fand es heuchlerisch. Ich erwiderte, auch die Aufhängung der Kopie sei ein Bekenntnis und sie fügte hinzu: ein verlogenes Lippenbekenntnis. Damals verzichtete ich darauf, weiter zu diskutieren, denn es lag mir auf der Zunge, Tina darauf hinzuweisen, dass sie ihr Studium nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus der mangelnden Begabung für das Verständnis von chemischen Zusammenhängen beendet hatte. Kurz gesagt, sie war zu doof gewesen, ich nicht. Dieser unausgesprochene Vorwurf schien mir unfair, nichtsdestotrotz wahr.
Als wir dann rauchend in der Scheune saßen, hing wieder stillschweigend der Vorwurf in der Luft, ich sei einer, der Wasser predige, aber Wein trinke. Ich dachte mir, dass an dem Vorwurf durchaus was dran sei, doch ich sah keine Alternative zum Wein, hob das Glas und prostete Tina zu. Sie rollte gerade einen Joint zusammen, das war auch nicht die Alternative und ich sagte ihr, dass ich nicht mitrauchen wolle.
14
Der weitere Abend verlief friedlich und produktiv. In den Hinterlassenschaften des Großvaters fanden wir nicht nur eine hübsche Luftpumpe, sondern auch einen 16-mm-Filmprojektor, der noch zu funktionieren schien. Zumindest drehte sich die leere Auffangspule und warf einen hübschen Schatten an die Wand. Das brachte mich auf die Idee, das Schattenspiel der vergessenen Dinge in meinen Film zu integrieren. Dazu brauchte ich Platz und deshalb schleppte ich endlich eine nennenswerte Menge Gerümpel in den Hof, so dass Tina Hoffnung schöpfte, die Umgestaltung der Scheune könne nun in die Gänge kommen. In der Tat schaffte ich es an dem Wochenende die Scheune fast leer zu bekommen und während der Arbeitswoche durfte ich an zwei Abenden mit dem klapprigen Kleinbus nach Hause fahren und konnte jeweils am nächsten Morgen eine Wagenladung mit sperrigen Altlasten zum Recyclinghof bringen. Im Videostudio des Jugendzentrums fand ich ein paar Rollen 16-mm-Film, bestimmt etwas pädagogisch Wertvolles. Die nahm ich mit, um den Projektor zu testen.
Am Freitagnachmittag ergab es sich, dass ich mal wieder mit Maria unterwegs war, die mich mit der Neuigkeit überraschte, der coole Kameramann würde aufhören, bei uns zu arbeiten. Obwohl es mich wunderte, von ihr davon zu erfahren, überwog die Freude. Wenn er ginge, wäre meine Position gesichert, dann wäre ich nicht mehr nur der Ersatzmann, sondern kontinuierlich an der Kamera im Einsatz. Maria erklärte auch noch, dass ich ihr Lieblingskameramann sei. Das war natürlich eine Schmeichelei, die vermutlich den Zweck verfolgte, dass ich mich dazu bereit erklärte, mit ihr am Wochenende das Reitturnier zu filmen, oder gar, was sich dann im Laufe des Gesprächs herauskristallisierte, dass ich das Reitturnier FÜR sie filmte, da sie selbst am Wettbewerb teilnehmen würde. Allerdings, so meinte sie, könne sie mich danach mitnehmen, zum Grillen bei ihr im Reitverein, wo es eine Menge gutaussehender junger Mädchen gäbe. Und deren Freunde, entgegnete ich. Nein, noch schlimmer: ihre Pferde. Auf dem Grill? Ich erlaubte mir schlechte Witze und machte mich über Pferde und Pferdemädchen lustig, denn ich wollte sowieso nicht auf die Pferdemädchenreitturniergrillparty, Martin würde zu Besuch kommen. Je mehr ich über Pferde schimpfte, desto mehr lachte Maria, sie war überhaupt nicht eingeschnappt, schließlich gab sie zu, dass sie mit dem Pferdetheater, das man von den jungen Reiterinnen gewohnt sei, nichts anfangen könne, aber als Sportart gefalle ihr das Reiten. Trotzdem lehnte ich dankend ab, was aber nichts nutzte, denn es stellte sich heraus, dass der coole Kameramann schon beim Umziehen war, der uncoole erst recht nicht wollte und der Chef meinte, ich solle dankbar sein, wie schnell ich in die wichtige Position als Kameramann hineinwachsen würde. Ich könne stolz sein, dass ich das Reitturnier aufnehmen dürfe. Dann klopfte er mir auf die Schulter und meinte, da gäbe es viele hübsche Frauen. Damit hatte er Recht, wie sich später herausstellte, aber es ärgerte mich die Bestimmtheit, mit der ich dazu abkommandiert wurde, mir den Samstag verderben zu lassen. Tina hätte mich trösten können. Das tat sie aber nicht, sie machte mir stattdessen Vorwürfe, dass sie sich dann um die Gäste kümmern müsse. Vermutlich empfand sie Genugtuung, dass mir mein Fernsehjob endlich mal zu viel wurde und ich ärgerte mich über ihre stille Schadenfreude. Was aber letztendlich alles nur Verschwendung von Emotionen war, denn am Freitag rief Martin bei Tina an und ließ ausrichten, sie kämen erst Samstagabend. Tina hatte wieder nicht nachgefragt, wer „wir“ sein würde. Ich meckerte Sie an, dass es von Wichtigkeit sei, wie viele Menschen bei uns übernachten wollten. Wieso, wir haben doch genug Platz, antwortete sie. Für mich ging es nur um die Frage, ob mit Sabine zu rechnen sei, was ich aber Tina nicht verriet.
Daran musste ich denken, als ich die Pferde filmte. So ein Turnier kann ganz schön lange dauern, vor allem wenn man sich nicht die Bohne für Pferde und ihr Gehopse über die Hindernisse interessiert. Am Anfang war es anspruchsvoll, die besten Positionen für die Kamera zu finden. Weil ich genügend Zeit hatte, übte ich bei einigen Durchläufen, ohne die Aufnahme zu starten. Ich wollte möglichst wenig Material aufnehmen, aber trotzdem das richtige, um mich bei den Cuttern beliebt zu machen, speziell bei Ulrich, der immer wieder mal sagte, zehn Minuten seien genug, wenn sie gut sind. Für alles, was über eine halbe Stunde hinausginge, hätte er gar keine Zeit, würde er sich gar nicht ansehen. Nachdem schließlich Maria vorbeigeritten war, die ich in voller Länge aufnahm, weil ich mich auch bei ihr beliebt machen wollte, langweilte ich mich bis zur Preisverleihung und erinnerte mich daran, wie Sabine damals gefragt hatte, was denn später aus uns und unseren Ambitionen werden würde. Dass ich Samstag am Reitplatz stehe und Pferde filme, wäre mir damals nicht als Antwort eingefallen. Aber abgesehen von meiner Ungeduld und dem ungünstigen Termin, war es eine angenehme Aufgabe, die mir sogar noch ein paar Grillwürste hätte einbringen können. Maria tat etwas enttäuscht, weil ich gleich fahren wollte, aber da kam auch schon ihr Freund und küsste sie. Ich hingegen packte meinen Kram, die Kamera und das Stativ und räumte es ins Auto, wo schon einige Bierkisten standen, die ich am Vormittag für die Filmvorführung am Abend eingekauft hatte. Als Entschädigung für die Samstagsarbeit hatte mir der Chef den klapprigen Kleinbus fürs ganze Wochenende überlassen und den Camcorder nahm ich auch mit nach Hause, um mir den Umweg ins Studio zu sparen. Gutgelaunt fuhr ich die kurvigen Landstraßen zwischen den hügeligen Äckern entlang. Ein einsamer Fahrradfahrer quälte sich die langgezogene Steigung hinauf, die zu unserem Dorf führte. Beim Überholen sah ich, dass es Gitarren-Hans war und bremste so kräftig, dass der Pseudo-Sportwagen hinter mir, dessen Fahrer schon die ganze Zeit vergeblich versucht hatte, mich zu überholen, ebenfalls quietschend bremsen musste. Dann, als der Gegenverkehr vorbeigezischt war, preschte er hysterisch hupend und die Arme wedelnd mit einem Affenzahn davon. Hans war verwirrt von dem plötzlichen Autotrubel um sich herum, aber als ich ausstieg, erkannte er mich. Das seien völlig unzurechnungsfähige Menschen, emotional getunt wie ihre übermotorisierten Karren, mit denen sie über die kleinen Straßen rasen, sagte er schnaufend, während wir sein Fahrrad auf die Bierkisten luden. Er war auf dem Weg zu Tina, oder vielmehr zu uns. Die beiden wollten für den Filmabend noch einen Drogenkuchen backen. Offensichtlich hatten sie ihre Zwistigkeiten wegen der Lieblingsschallplatte inzwischen vergessen oder geklärt.
Tina empfing ihn mit einer Umarmung und mich mit der Nachricht, dass wiederum Martin vor Kurzem angerufen hätte. Er, beziehungsweise sie, drei Männer, seien jetzt schon in Deutschland an der Grenze und die drei Männer fragten an, ob auch ein paar Frauen zum Filmabend eingeladen sein? Also keine Sabine! Und keine Grillpferdemädchen. Aber Tina hatte schon den Teig angerührt und Gitarren-Hans eine weitere wichtige Zutat dabei. Der Kuchen, der daraus entstehen sollte, war nicht nur für Martin und seine Kumpels, sondern auch für Tinas Bardamenkollektiv, wie sie sich und ihre Kolleginnen hinter dem Tresen bezeichnete. Sie und einige der Stammgäste wollten endlich mal sehen, wo wir uns auf dem Dorf versteckt hielten und hatten versprochen, auf jeden Fall zu kommen. Ulrich hatte ich als einzigen meiner Fernsehkollegen eingeladen, aber er musste zu irgendeinem Familienfest, das fand ich schade. Martin würde noch einige Stunden auf der Autobahn verbringen, Hans und Tina waren in der Küche zugange und ich konnte in aller Ruhe die drei Projektoren aufbauen, den guten Super-8-Projektor in der Scheune, den alten im Hof.
Dann kümmerte ich mich um den 16-mm-Projektor, für den ich im Jugendzentrum eine Filmrolle mitgenommen hatte. Ich putzte ihn ordentlich aus und als ich den Film einlegte, stellte sich heraus, dass der Projektor einwandfrei funktionierte. Also konnte ich eine Endlosschleife herstellen. Ich musste nur eine geeignete Passage im Filmmaterial finden. Der Film aus dem Jugendzentrum schien zunächst ziemlich öde, es ging wie erwartet um die Probleme von Jugendlichen. Er zeigte, wie diese Probleme durch die Besinnung auf den christlichen Glauben gelöst werden. Die meiste Zeit wurden Interviews geführt, oder langweilige Diskussionsrunden. Erst am Ende des Filmes gab es einige gelungene Aufnahmen der Probleme, da führte eine Kamerafahrt durch unglaublich viele leere Bier- und Weinflaschen und dann war da auch noch ein kotzendes magersüchtiges Mädchen, dessen Gekotze man nicht richtig sehen konnte, aber die Körperhaltung und Bewegung waren eindeutig.
Da hatte ich also ein schönes Stückchen Film, das ich in den Projektor einfädelte und dann den Anfang an das Ende klebte. Zwar fehlte mir eine entsprechende Klebelade, aber die war nicht unbedingt nötig. Bei 16-mm-Film konnte man jedes einzelne Bild gut mit bloßem Auge erkennen. Einfach die Perforation übereinanderlegen, zur Deckung bringen, dann ein schneller Schnitt mit der Haushaltsschere, die Enden stumpf aneinandergefügt und mit Tesafilm zusammengeklebt, schon fertig. Außerdem hatte ich inzwischen die erste Rolle Schwarzweiß-Film entwickeln lassen und es gab ein paar Sekunden, die die drehende Spule des Projektors und ihren riesigen Schattenwurf an der Scheunenwand zeigten. Diese Aufnahme, etwa 50 cm, kam als Endlosschleife in den alten Super-8-Projektor und gleichzeitig wurde der laufende 16-mm-Projektor mit einer Lampe angeleuchtet, so dass dessen Spule, die bei einer Endlosschleife eigentlich gar nicht nötig war, einen bewegten Schatten warf, der sich mit der Projektion überlagern würde.
Tina und Gitarren-Hans kamen in den Hof, eine Weinflasche und Gläser in den Händen. Während des Einschenkens startete ich die beiden Schleifen zum ersten Mal gleichzeitig. Es war noch etwas zu hell, aber vage zeichnete sich das Bild an den Wänden ab. Ich hatte einiges ausprobiert. Inzwischen kotzte das Mädchen rückwärts und das Bild stand auf dem Kopf, da konnte man durchaus auf die Idee kommen, es sei ein Ausschnitt aus einem Pornofilm. Auf der anderen Mauer überlagerten sich die echten und gefilmten Schatten der Projektorspule, das gefiel mir sehr gut. Es fehlte nur noch ein Soundtrack. Ich schlug vor, dass Tina ihren monophonen Synthie holen könnte, was ihr nicht in den Kram passte, aber schließlich erlaubte sie Gitarren-Hans, den Synthie zu bedienen, wenn er sich selbst um alle kümmern würde. Hans kannte sich überraschend gut mit dem Gerät aus oder verstand es intuitiv. Während er die ersten zaghaften Töne erzeugte, rückte ich nochmals meine Projektoren herum, suchte die jeweils optimale Position und da es inzwischen dunkel geworden war, sah es sehr beeindruckend aus. Gitarren-Hans drehte an Tinas altem Gitarrenverstärker die Höhen raus, die Bässe rein und holte knatternde, tiefe Töne aus dem Synthie, die er durch das Drehen an den Filtern ganz langsam veränderte. Wieder traf er bei mir eine Resonanz, die mich mitnahm, mich durchdrang, dieser spröde technische Ton, der kein Ende zu haben schien, sondern nur einen Puls, während die Schatten rotierten und das auf dem Kopf stehende Mädchen aussah, als kotze und vögle sie gleichzeitig. Der erste Schluck Rotwein dieses Abends, ein dazu gereichter Joint, ich spürte es in der Kehle, in der Lunge und schon kurz darauf im Kopf, wie es brummte, Gitarren-Hans drückte auf die Tastatur, es ging einen Halbton runter, noch tiefer, dazu ein Blubbern und Knarzen, das ich so empfand, als würde uns dieser Klang einschließen, einhüllen, beschützen, als sei der Klang unsere Welt, hier sind wir sicher und unter uns, keine Ikonen oder Turniere, keine fragwürdigen Gedanken, was wir tun und lassen mussten, um an Geld zu kommen, sondern einfach SEIN und machen, was ICH will, einfach loslegen, wir erzeugen mentale Energie auf unserem eigenen Planeten, und da kam das erste Auto mit Gästen, die Autoscheinwerfer überstrahlten für einen Moment gleißend die Projektion und erloschen schnell wieder, aber es war nicht Martin, sondern zwei von den Bedienungen aus der Szenekneipe, Tinas Bardamenkollektiv, die Blonde und die Rothaarige, und die Blonde schien mich zu mögen, küsste mich zur Begrüßung, fragte irgendetwas, was ich nicht verstand und ich war so verwirrt, dass ich sie einfach noch mal umarmte. Ich fand es toll, dass sie gekommen war, sagte es ihr und meinte, sie solle es sich gemütlich machen, auf unserem kleinen Planeten.
15
Die blonde Bedienung machte es sich tatsächlich gemütlich, holte sich einen Klappstuhl, den sie neben meinen Clubsessel hinstellte und so saßen wir in der Mitte des Hofes mit dem besten Blick auf die Endlosschleifen. Sie verwickelte mich in ein Gespräch über die Stammkundschaft in ihrer Kneipe, zu der auch ich gehörte und das war ein schier unerschöpflicher Stoff. Am Anfang fand ich es sehr interessant, dann ergriff mich zunehmend die Ungeduld, denn ich fragte mich, wann Martin ankommen würde. Stattdessen trafen weitere Freunde und Bekannte ein, mit denen ich teilweise kurz plauderte, aber letztendlich saß ich immer wieder neben der blonden Bedienung in der Mitte des Hofes. Gitarren-Hans kündigte an, dass er nicht mehr lange an den Reglern des Synthies drehen würde, andere Gäste wollten Musik hören, wieder andere forderten die Filmvorführung. Auf den dreihundert Kilometern von der Grenze bis zu uns konnte Martin einiges dazwischengekommen sein. Womöglich traf er erst um Mitternacht ein, solange wollte ich nicht warten. Darum holte ich den Camcorder in den Hof, um die Projektion abzufilmen, solange Gitarren-Hans den Synthie am Laufen hielt. Er drehte feinfühlig an den Filtern, so dass das Blubbern an Intensität gewann und wunderbar zu meinen Endlosschleifen passte. Auch wenn die Aufnahmen etwas lichtschwach waren. Als schließlich die blonde Bedienung als dunkle Silhouette vor den kreisenden Schatten tanzte, sah das sehr gut aus. Die Videoaufnahme meine Installation wäre später oder am nächsten Tag gar nicht mehr möglich gewesen, denn im Lauf des Abends riss die Super-8-Schleife und im 16-mm-Projektor brannte die Birne durch. Aber erstmal kamen zwei Autos voll mit Stammgästen der Szenekneipe, von denen mir die blonde Bedienung erst kurz zuvor diverse Details erzählt hatte. Sie johlten laut, als sie mit zwei Bierkästen in den Hof traten. Ganz schön prollig, dachte ich mir, aber ich ließ zur Einstimmung meinen damals einzigen Zeichentrickfilm laufen, ganz einfache Strichmännchen, die zunächst Bierkrüge leerten, diese dann aufaßen und letztendlich kotzend umfielen. Das gefiel den prolligen Gästen und ihre Stimmung blieb gut, auch als Tina frühen Elektro-Punk auf den Plattenteller legte. Das war keine Konsensmusik. Der Großteil der Landbevölkerung schwelgte musikalisch immer noch in den 70er-Jahren. Zwischendurch zeigte ich ab und zu einen meiner frühen Filme. Schließlich fädelte ich auch „Die Rückbesinnung“ ein, die nach meiner ursprünglichen Planung erst nach Martins Ankunft laufen sollte. Es war schon halb zwölf, die Gäste betrunken, lange konnte ich nicht mehr warten. Aber, als hätte ich eine Vorahnung gehabt, tauchte kurz vor der Schlussszene ein ankommendes Auto den Hof in grelles Licht und während der Abspann lief, traten Martin, Achim und ein Unbekannter in die Scheune.
Sie erkannten, dass es ihr Film gewesen war und die Gäste erkannten die Hauptdarsteller, was auf beiden Seiten Begeisterung auslöste. Wir umarmten uns zur Begrüßung und ohne viel zu reden, waren wir uns sofort einig, dass ich gleich den falschen Film einlegen sollte, den Film, bei dem nichts zusammenpasst und eigentlich passte das ja wirklich nicht, es passte eben auch nicht zu den sogenannten normalen Zuschauern, aber diesmal, da war das eben anders, denn schon in der ersten Szene machte Martin flüsternd einen Witz, woraufhin Achim und der unbekannte Dritte laut lachten und ab diesem Moment fanden die drei alles, was in dem Film passierte, umwerfend witzig und grölten und klopften sich auf die Schenkel, was auch die anderen dazu animierte, alles irrsinnig lustig zu finden, und schließlich verstand man kaum noch die absurden Dialoge, weil das Publikum außer Rand und Band war, so dass ich den Film gleich nach dem Zurückspulen noch einmal einlegte und wir schauten ihn mit der gleichen Begeisterung zum zweiten Mal an. Martin und Achim begeisterten sich genauso, wie damals bei der Rückbesinnungs-Premiere in Martins Wohnung, damals, als wir uns so sehr über die Idee amüsierten, was wir falsch machen könnten und jetzt amüsierten wir uns, was ich tatsächlich falsch gemacht hatte.
Ab und zu fiel eine abfällige Bemerkung über die „Ars Electronica“ oder über die Gepflogenheiten der wichtigen Künstler in Berlin, Seitenhiebe gegen oder zynische Kommentare über das große, verkopfte Kulturestablishment, zu dem Martin, Achim und der unbekannte Dritte, von dem ich am nächsten Tag erfuhr, dass er Stefan hieß und ein Studienkollege Martins an dieser digitalen Kunstakademie war, leider noch nicht gehörten. Später vermutete ich, dass die digitalen Erstsemesterkünstler und Achim, der ewige Student für nutzlose geisteswissenschaftliche Fächer nach der schwierigen Eingewöhnung in die Verhältnisse der Metropole und einem Trip zur elektronischen Weltkultur endlich aufatmeten, denn hier, zwischen den Rüben- und Getreideäckern, in der aus Muschelkalk gemauerten Scheune unseres bescheidenen Bauernhofes war die Hierarchie der Verhältnisse plötzlich auf den Kopf gestellt oder vielmehr: wieder zurück auf die Füße.
In meinem Film war alles falsch, doch die Vorführung rückte es in die richtige Rangordnung, in unsere Rangordnung. Die Dreierbande aus Berlin hatte sich schon durch die Ankündigung ihres Kommens mit mir verbündet und gemeinsam konnten wir die Stimmung des Abends kontrollieren und das taten wir genussvoll. Hier waren wir die Kulturelite. Es gab schließlich noch die Vorführung einer meiner kurzen Super-8-Klassiker, „Sulos Tod“, der ausschließlich zeigte, wie ich eine Metall-Mülltonne zerstörte, nichts Besonderes, aber emotional effektiv. Bevor die Plastikmülltonnen eingeführt wurden, stand auf allen Mülltonnen „Sulo“, vermutlich der Hersteller. Tina kam auf die Idee, dass wir auch noch eine alte Mülltonne dahätten und deshalb drückte ich Martin den Camcorder in die Hand, damit er meine Performance filmte, positionierte den Scheinwerfer, der den ganzen Abend nur dazu gedient hatte, den Schatten der Filmspule zu erzeugen, und dann steigerte ich mich in die banale Zerstörung der Mülltonne hinein, als ginge es darum eine untergehende Welt zu retten.
Ich drosch mit dem Vorschlaghammer auf die Tonne ein, bis sie nur noch ein Klumpen verbeulten Blechs war. Die anderen feuerten mich an und grölten, wenn mir ein Schlag gelang, der die Tonne deutlich verformte. Es machte einen Heidenlärm. Zwischendurch bekam ich es mit der Angst zu tun, die Nachbarn könnten uns die Polizei auf den Hals hetzen, aber da unser Gehöft etwas abseits stand, schien im verschlafenen Dorf niemand das Bedürfnis zu verspüren, uns den Spaß zu verderben. Ich zog mir den Pullover aus und keuchend und schwitzend schlug ich auf die verbeulten Überreste der Mülltonne ein. „Sulos Tod“, Version Zwei, diesmal mit dem Originalton.
Die erste Version, die wir ein paar Jahre zuvor in einem Steinbruch gedreht hatten, war vollständig nachsynchronisiert worden. Im Bild schlug ich wie ein Wilder mit der Axt auf die Tonne ein, aber die Geräusche hatte ich im Keller meiner Eltern mit einigen Blecheimern und einem normalen Hammer erzeugt. Bei der Videoaufnahme in der Scheune knallte es hingegen richtig und das Raunen und Jubeln der Zuschauer war auch mit auf der Tonspur. Wir, also Martin und ich, schauten uns einen Teil der Zerstörungsorgie im Sucher der Kamera an, der sie nur schwarzweiß und stumm wiedergab, trotzdem waren wir hellauf begeistert. Von allem. Nicht nur die Aufnahme, sondern auch das Zusammentreffen, die Übereinstimmung, der Konsens und die Freundschaft. Und alles andere auch noch. Jetzt konnten wir uns endlich einfach unterhalten, über meine Aufgaben als Kameramann und Martin über seine Akademie und Achim über geheime Kellerbars in Ostberlin und Stefan über die „Ars Electronica“.
Jetzt war Schluss mit der Angeberei, wir wollten schließlich erfahren, was in der Zwischenzeit passiert war. Das Reizthema Sabine hatte ich dabei völlig vergessen, aber Martin erzählte ganz beiläufig, dass er mit ihr schon längst nicht mehr zusammen sei, das wäre ja nur so eine kurze Sache gewesen. Er überlegte, rückte aber nicht damit heraus, was er Schlechtes über sie sagen wollte. Mir war es egal, ich war sowieso gerade sehr euphorisch und hin und wieder wechselte ich einen Blick mit der blonden Bedienung. Als Martin sich dann in eine zu lange und zu komplizierte Abhandlung über Bildbearbeitung mit Computern verstrickte, konnte ich beim besten Willen nicht mehr folgen, seilte mich ab und fand wieder den Platz in der Mitte des Hofes, wo sich die blonde Bedienung auch gleich neben mich setzte. Jetzt erzählte ich ihr über meine Filme, was ein ebenso unerschöpfliches Thema war wie ihre Stammgäste. Aber es gelang uns, verbale Ausschweifungen zu vermeiden und relativ bald lagen wir bei mir im Bett, während die Party draußen bereits leiser wurde.
16
Der Sonntag war viel zu kurz. Ich hatte im Morgengrauen noch Spaß mit der blonden Bedienung, aber sie ging dann ohne Frühstück, musste irgendwohin und fuhr, bevor die anderen aus den Betten krochen. Bei Tina war offensichtlich auch jemand geblieben, sie holte sich zwei Tassen Kaffee aufs Zimmer. Obwohl sie es schaffte ihren Gast vollständig meinem Blick zu entziehen, war mir klar, dass es Gitarren-Hans sein musste. Martin, Achim und Stefan kamen gegen zehn in die Küche und wollten möglichst schnell aufbrechen, weil die Strecke nach Berlin jetzt, mit geöffneter Grenze, keineswegs schneller ging, sondern wegen einiger Baustellen manchmal in einem großen, endlosen Stau versank. Beim Kaffee ereiferte sich Martin nochmal über die grandios sinnlose Integration seiner Gummientensammlung in den falschen Film und versteifte sich in die Aussage, dass der Film unbedingt in Berlin laufen müsse.
Ich widersprach, meinte, ich hätte ja schon ab und zu Filme zu Festivals geschickt, aber die zeigten ja immer nur das, was ich als sogenannten konzeptuellen Edelmist bezeichnete. Genau, aber der falsche Film sei doch konzeptueller Edelmist, wie man ihn sich besser nicht vorstellen könne. Nein, überhaupt nicht, der ist Trash, Genialer Dilettantismus, aber ein bisschen zu wenig genial. So ein Schmarrn, warf Achim ein, und Martin sagte, ich sei vom Leben auf dem Land desensibilisiert für die ästhetischen Nuancen, woraufhin ich die kulturelle Überfütterung in den Metropolen anprangerte, die die Künstler scharenweise in stilistische Extremgebiete hineintreibe, wo es nur noch darum ginge, dass man was „total Abgefahrenes“ mache, auch wenn es keinen Sinn hätte, oder vielmehr sei die totale Sinnlosigkeit eines der typischen Merkmale dieser „total abgefahrenen“ Kunstverwirrungen und das fände eben auch in den Film- und Videofestivals seinen Niederschlag. Rein konzeptuelle Kopfgeburten, humorlos, aber unermüdlich von Sinn-Totalverweigerern zusammengefummelt, dominierten oder vielmehr blockierten die Leinwände, so dass für diejenigen, die etwas unverkrampfter an die Materie herangingen, kein Platz mehr sei. Jetzt fing Stefan an zu widersprechen, der sowohl bei der „Ars Electronica“, als auch in irgendwelchen Kulturkinos unzählige beeindruckende filmische Werke gesehen hätte, die er mir am liebsten alle erzählen wollte, inclusive der dahin steckenden Konzepte. Damit durfte ich mir nicht das Frühstück verderben lassen. Ich gab nach und holte die Spule mit dem falschen Film, drückte sie Martin in die Hand, er solle darauf aufpassen und dann könne er sich drum kümmern, eine Vorführung in Berlin zu organisieren, ich würde dann vielleicht auch mal wieder vorbeikommen, zumal, was Sabine anging, inzwischen die Luft rein war. Umarmungen am Auto, dann brausten sie davon.
Im Hof stand das Fahrrad von Gitarren-Hans und Tina war nur ein paar Mal als vorbeihuschender Schatten zu sehen. Stattdessen überraschte mich Maria, die mich anrief, ob ich mit ihr Kaffee trinken wolle und ob ich dann auch die Videokassette mit den Reitturnieraufnahmen mitbringen könnte. Charmant, aber vergebens, denn auf Pferde hatte ich gerade gar keine Lust, es graute mir auch schon vor dem Montag, an dem ich wieder zum Schrebergartenfernsehen zurückmusste. Viel lieber hätte ich mir die Aufnahmen meiner Mülltonnenperformance auf einem großen Monitor angeschaut, aber da wir weder einen S-VHS-Rekorder noch einen Fernseher zuhause hatten, packte ich die Kamera an dem Tag gar nicht aus. Ich musste dann aber am Montagmorgen dringend Ulrich sagen, dass meine wichtigen künstlerischen Aufnahmen auf dem gleichen Band aufgezeichnet waren wie das Turnier, damit er die Kassette nach dem Schnitt beiseitelegte und mir eine Kopie zog.
Aber als ich ins Büro kam, Kamera am Arm und das Stativ geschultert, wollte mich der hektische Redakteur am liebsten gar nicht rein lassen, weil er meinte, ich solle dringend in die Kirche, genaugenommen in den Dom, dort sei die Polizei am Spurensichern, weil ein Diebstahl geschehen sei, und wenn ich erst am Tatort einträfe, wenn die Polizei schon weg sei, dann hätte ich den wirklich schrecklichen Fall, dass ich das NICHTS filmen müsse und das sei das Schlimmste, was uns Fernsehbildberichterstattern passieren könne. Er erlaubte mir gerade mal, die bespielte Kassette mit den Pferdeaufnahmen auf den Stapel zu legen, wo sie Ulrich oder ein anderer Cutter, wer immer es auch sein möge, finden könnte, denn es hatte ja geheißen, dass die Pferdegeschichte gleich am Montag geschnitten werden müsse. Dann schnappte ich mir einen Stapel frischer Akkus und ging mit dem Redakteur in den Dom, der nur ein paar hundert Meter vom Büro entfernt war. Das ist ganz schön weit, wenn man es eilig hat und schwer tragen muss. Es stellte sich heraus, dass die Hetzerei unnötig gewesen war, da die Polizeibeamten, die in einem Seitenschiff rings um eine Absperrung herumstanden, sehr wortkarg waren. Wir konnten nicht erkennen, ob sie etwas taten und, wenn ja, was. Diese unidentifizierbare Tätigkeit schienen sie in Extremzeitlupe zu erledigen. Keiner verriet, ob er etwas wissen würde, oder ob er dieses Wissen preisgeben durfte. Trotzdem machte ich einige Aufnahmen, wobei mich die Polizisten mürrisch anschauten, aber offensichtlich hatten sie keine klare Anweisung erhalten, ob das Filmen und Fotografieren erlaubt sei.
Schließlich hastete ein Geistlicher in brauner Kutte vom Seiteneingang auf uns zu, zwei Fotografen klebten an seinen Fersen. Er gestikulierte und redete ununterbrochen, schaffte es dabei, uns zu begrüßen, ohne in seinem Redeschwall nachzulassen. Während die Fotografen wild losblitzten, bekamen wir erklärt, dass der heilige Liborius entwendet worden sei, oder vielmehr der letzte Knochen, der von ihm übriggeblieben war. Den heiligen Liborius kannten wir natürlich nicht, aber so langsam verstanden wir, dass eine Reliquie samt Reliquiar fehlte, also das Überbleibsel eines Heiligen mitsamt der Aufbewahrungsdose. Da gab es wirklich nicht viel zu filmen, zumal die Polizisten trotz des Redeschwalls des Geistlichen nicht aus ihrer Zeitlupe erwachten. In der Dombibliothek sollte es ein Foto vom geklauten Reliquiar geben, da gingen wir also auch noch hin und filmten das Foto ab. Das machte man damals so, weil es keine E-Mail und keine digitalen Fotos gab. Bestenfalls gab es Faxgeräte, die die Fotos zu schwarzweißen Bilderbrei verunstalteten. Im Nachrichtenbereich waren die Faxgeräte damals das bevorzugte Kommunikationsmittel. Alles, was es an Pressemitteilungen und Neuigkeiten gab, wurde über Faxgeräte gesendet. Als wir in die Redaktion zurückkamen, hatte sich dort schon ein beachtlicher Haufen an Faxpapier angesammelt. Alles unbearbeitete Themen, um deren Sortierung sich der Redakteur nicht kümmern konnte, weil er den gestohlenen Heiligen zu wichtig genommen hatte. Das ärgerte ihn jetzt.
Maria, die als Praktikantin an einem Schreibtisch in der Ecke saß, bekam einen Anschiss, weil sie die Faxe noch nicht vorsortiert hatte, woraufhin sie sich verteidigte, dass sie ihre Zeit mit der Suche nach dem Pferdeturniermaterial verplempert hätte und Ulrich würde mich dringend brauchen, um ein Problem zu lösen. Der Redakteur, der gerade das meterlange Faxpapier überflog, meinte, ich solle jetzt mal kurz dableiben, damit wir gleich besprechen könnten, was heute zu tun sei und ich erklärte Maria gereizt, dass ihr Reitturnier doch dort sei, wo es hingehöre und sie meinte wiederum, dass sie es aber nicht finden könne. Um elf sei die Pressekonferenz im Rathaus, da müsst ihr hin, ließ der Radakteur ungeachtet unseres Disputes verlautbaren, und um 14 Uhr kümmert ihr euch um das Technische Hilfswerk, die haben eine neue Koordinationszentrale für Katastropheneinsätze.
Jetzt durfte ich abtreten, zu Ulrich in den Schnittraum, bei dem auf allen Monitoren Bilder vom letzten Hochwasser zu sehen waren. Ich glaube, es ist was schiefgelaufen, meinte er, während er eine Kassette wechselte. Was denn, fragte ich. Du musst zurückspulen, weil wir hinter den Pferden noch was aufgenommen haben. Eben nicht! Über die Pferde, da schau … hier ist ein Pferd … er zeigte mir eine kurze Aufnahme, die ganz am Anfang des Turniers entstanden sein musste, dann flimmerte das Bild, Störstreifen und es baute sich langsam das neue Bild auf, ich und die Mülltonne. Mach lieber mal die Tür zu, sagte Ulrich und ich starrte gebannt auf meine Performance, von der weite Bereiche im tiefen Schwarz verschwanden, aber das Blech schepperte bei jedem Schlag unglaublich laut, so dass man gut hören konnte, was man wegen der schlechten Belichtung nicht sah. Das ist nicht lang, stotterte ich, und in der Tat, Ulrich spulte kurz weiter, da sahen wir, wie ich gerade mit der Mülltonne fertig war und den Vorschlaghammer hinschmiss. Es erschien wieder ein Pferd, hoppelte über den Parcours, dann nochmal Aufnahmen von unserer Party, auf denen Martin seine beiden Freunde filmte und ich gar nicht zu sehen war. So ein Mist, das konnte doch nicht wahr sein, was hatte Martin, dieser Idiot gemacht? Ulrich spulte wieder etwas vor, bis erneut Maria zu sehen war, wie sie ins Ziel einritt, eine mittelmäßige Aufnahme, weil ich es darauf angelegt hatte, ihren gesamten Parcours zu erwischen. Dann die Siegerehrung und schon brach das Bild wieder zusammen. Es folgte meine Aufnahme von der Filmschleifeninstallation. Das konnte doch nicht wahr sein! Wir Idioten hatten das Material vom Pferdeturnier teilweise überspielt, also unwiederbringlich gelöscht! Die Mühe, die ich mir gegeben hatte, alles möglichst kurz und knapp zu filmen, bewirkte nun, dass kaum etwas übrig blieb. Ich brauche immer erst mal zehn Sekunden für den Preroll, sagte Ulrich, dann ist der kleine Rest auch noch unbrauchbar. Es sei denn, ich ziehe erst mal ‘ne Crash-Kopie. Das sollen wir aber nicht machen, wegen dem Qualitätsverlust beim Kopieren. Wenn Cutter mit ihren vielen Fachausdrücken argumentierten, war ungewiss, ob sie nicht wollten, oder wirklich nicht konnten. Du musst da noch was rausholen, bat ich ihn, und er antwortete, das wird anstrengend. Maria steckte plötzlich ihren Kopf zur Tür herein. Ich schaute sie schuldbewusst an und sagte, Scheiße, es ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Ulrich drückte wirr auf ein paar Tasten seiner Schnittanlage und fügte ganz sachlich hinzu, es sei nur das Zweitschlimmste. Maria reagierte überhaupt nicht darauf. Wir müssen los, sagte sie, ins Rathaus, Pressekonferenz. Tatsächlich, schon 20 vor elf. Also wieder ran an die Kamera, Akkus holen, Kassette einlegen und möglichst geschäftig tun, um von der Katastrophe mit den Pferdebildern abzulenken. Solange Maria nicht fragte, brauchte ich nichts sagen, aber das waren nur 30 Sekunden. Als wir am Lift standen und warteten, schaute sie mich mit einem merkwürdig undefinierbaren Gesichtsausdruck an und fragte, ob ich denn nun das Material vom Reitturnier gefunden hätte. Ja! Ich konnte bestätigen, dass ich es gefunden hatte, aber ich musste, als wir im Lift nach unten fuhren, einschränkend hinzufügen, dass das Material nicht ganz in Ordnung sei. Wie? Nicht in Ordnung? Nicht vollständig, da fehle wirklich ein Teil, eigentlich der größte Teil und ich könne auch nicht erklären, wie das habe passieren können. Gleichzeitig dachte ich mir, dass ich natürlich wusste, dass es daran lag, dass wir das Material gelöscht hatten, dass es total fahrlässig gewesen war, die Kamera unbeaufsichtigt auf der Party herumstehen zu lassen, dass es das mindeste für einen Kameramann gewesen wäre, eine eigene Videokassette zu benutzen und die Pferdeturnierkassette an einen sicheren Ort zu verwahren, aber ich meinte genaugenommen, dass ich mir nicht erklären konnte, WIE wir es gelöscht hatten, zumal wir nur geringfügig betrunken gewesen waren. Wenn wirklich was schief geht, soll es so aussehen, als sei die Technik schuld, die Technik verstehen nur die Techniker und wenn ich genauer darüber nachdachte, schien es mir wirklich nicht nachvollziehbar, wie uns das passieren konnte, die einfachste Erklärung war wirklich, dass der Camcorder von alleine die Rückspulfunktion ausgelöst und uns damit ein bösen Streich gespielt hatte. Vielleicht waren es aber auch die Mainzelmännchen gewesen. Wie unvollständig, fragte Maria, weil ich gar nichts mehr sagte, sondern nur vor ihr her zum Auto trottete und die Technik verstaute. Sollte ich ihr gleich gestehen, wie unglücklich die Lage war, oder konnte ich sie ein bisschen vertrösten, damit sie noch Hoffnung hatte, während wir gemeinsam unterwegs waren? Ziemlich unvollständig, sagte ich schließlich beim Einsteigen, ich drehe dir dafür einen schönen Bürgermeister. Aber ich will keinen Bürgermeister, sondern die Pferde! Oh nein, du brauchst auch den Bürgermeister, vergiss die Pferde! Die vergesse ich nicht, und weißt du, dass in zwei Wochen das nächste Turnier stattfindet? Sie war hartnäckig, aber offensichtlich trug sie es mit Fassung. Die Pressekonferenz erheiterte uns, weil der Schlips des Bürgermeisters genau die gleiche Farbe hatte wie die Bluse seiner Referentin und der Pressesprecher die passenden Socken dazu trug. Sie berichteten über die üblichen Banalitäten: Straßenbau, Gebührenerhöhung und Hochwasserschutz. Zu guter Letzt fiel ihnen aber tatsächlich ein, dass im Dom die Reliquie des heiligen Liborius entwendet worden sei, was ja gar nicht ihre Zuständigkeit berühre, da es sich um eine reine Kirchenangelegenheit handle, aber der Bürgermeister mit seinem orangefarbenen Schlips wies darauf hin, dass die Stadt unter dem besonderen Schutz des Heiligen stehe und er inständig hoffe, dieser Schutz bliebe auch erhalten, wenn die Reliquie verschwunden sei. So ein Unfug, dachte ich mir und freute mich, dass die Referentin den Bürgermeister angesichts dieser Aussage stirnrunzelnd und strafend anschaute. Aber der Pressesprecher setzte noch einen drauf und empfahl den Bürgern der Stadt, zu beten. Da hätte ich mich fast verschluckt und musste meinen Heiterkeitsausbruch unterdrücken. Die hofften, sie könnten die Reliquie wieder herbeibeten. Und ich hoffte, Ulrich würde unterdessen irgendwie unser gelöschtes Pferdematerial herbeizaubern, tat er aber nicht. Als wir zurückkehrten, war er immer noch mit den Hochwasserbildern beschäftigt, die für den Studiogast vom Katastrophenschutz vorgesehen waren. Er schimpfte leise vor sich hin, dass ihm das alles nicht gefalle, das Rohmaterial nicht, der Schnitt nicht und die Probleme mit Kameramännern, die ihr eigenes Material löschten, gingen ihm auch ganz schön auf den Sack.
Und mir geht die Kamera auf den Sack, entgegnete ich, denn ich war gerade dabei, einen Test durchzuführen. Am Schnittplatz gab es eine große Digitaluhr mit Sekundenanzeige, die filmte ich, stoppte dann die Kassette und spulte zurück. Schaute mir dann die Uhr im Sucher an. An der Uhr konnte ich genau ablesen, wann ich die Kassette stoppte. Man hörte am Geklacker des Laufwerkes, dass der Rekorder das Band ausfädelte. Als ich in Aufnahmebereitschaft ging, klackerte es nochmal, der Rekorder fädelte das Band wieder ein. Bei Videorekordern wird das Band um eine große Kopftrommel herumgeschlungen, und die Kopftrommel dreht sich in einem Affenzahn, denn es müssen 25 Bilder in jeder Sekunde aufgenommen werden, und jedes Bild besteht aus 768 Zeilen und für jedes Bild schreibt der Magnetisierungskopf, der sich auf der rotierenden Kopftrommel befindet, eine schrägliegende Spur auf das Magnetband. Es war beachtlich, dass das alles überhaupt funktionierte. Aber wie ich bei der Aufnahme von der Digitaluhr sehen konnte, sorgte dieser Mechanismus dafür, dass das Band beim Einfädeln, oder beim Ausfädeln, zwanzig Sekunden nach hinten gezogen wurde, und deshalb wurden diese zwanzig Sekunden gelöscht, wenn man das Bandmaterial spulte, stoppte und erneut eine Aufnahme startete. Das erklärte, warum beim Reitturnier einige kleine Stellen fehlten, aber es war natürlich keine Entschuldigung für unser Versagen auf der Party. Trotzdem erleichterte es mich. Ich konnte dem Camcorder eine Mitschuld anhängen und von mir ablenken. Das versuchte ich sofort, als Maria nochmal zu uns kam. Sie fragte, ob wir gerade löschten oder was Konstruktives machten. Die Kamera ist schuld, rief ich und es schien sie zu freuen. Obwohl der launische Chef nichts von unseren Problemen wusste, hatte er gesagt, dass vom Turnier nur eine Kurznachricht gesendet werden solle, weil wir einen anderen Beitrag dringend auf Sendung bringen müssen, damit der Werbekunde nicht sauer werde. Ich atmete auf und Ulrich sagte, eine Kurznachricht könne er uns schnell zusammenhacken, inklusive Maria auf dem Pferd, auch wenn das mit dem zerstückelten Material und den daraus resultierenden Timecodesprüngen etwas komplizierter sei als sonst. Ich hätte gerne ein paar spöttische Bemerkungen gemacht, zu diesen vielen Widrigkeiten, die angeblich den Cuttern das Leben erschweren, dabei sitzen die doch immer im Warmen, amüsieren sich über die Fehler der anderen und das wichtigste Ziel ist es, die vielen Knöpfe ihrer Schnittsteuerung so schnell zu bedienen, dass keine Außenstehender es jemals begreifen wird, was sie da überhaupt machen. Als Kameramann war man angreifbarer, wenn da was schief geht, war es im schlimmsten Fall unwiederbringlich verloren, so wie Marias Pferdeaufnahmen. Die paranoide Angst, ich gehe irgendwo hin und filme, aber dann, wenn ich zurückkehre, ist nichts auf den Bändern, oder das falsche, oder ich schaffe es gar nicht, bis zu dem Ort zu kommen, wo ich die Aufnahmen machen soll, ließ im Lauf der Jahre nach, machte sich aber in schwachen Momenten immer wieder bemerkbar. Diesmal kam ich trotz allem glimpflich davon, stattdessen war es Maria, die eine kritische Bemerkung vom Chef über sich ergehen lassen musste. Das war nicht fair, quasi ein Kollateralschaden der Bemühungen von meinem Versagen abzulenken. Denn bei der Abendbesprechung hielt ich einen geschwätzigen Vortrag darüber, dass man mit den neuen Camcordern höllisch aufpassen musste, weil sie, wie ich herausgefunden hätte, bis zu 20 Sekunden löschen würde, wenn man im Material herumspult. Das hatte noch nicht mal der uncoole Kameramann gewusst und der Chef bedankte sich für meine gewissenhafte Technikkontrolle, ohne zu fragen, wieso ich diese Tests eigentlich gemacht hatte. Die Kurznachricht über das Pferdeturnier wurde dann erst im weiteren Verlauf der Besprechung vom Chef als ziemlich unzusammenhängender Mist beschimpft, wobei er Maria als Sündenbock ausmachte und ihr empfahl, sie solle nicht selber reiten, wenn sie fürs Fernsehen unterwegs sei. Mein peinliches Versagen blieb dabei unerwähnt, Maria und Ulrich, die als einzige davon wussten, hielten die Klappe und ich sagte auch nichts.
17
Der Chef konnte ein ziemliches Ekel sein, deshalb waren wir uns untereinander immer einig, dass er an allem schuld sei. Auch in Fällen von unbestreitbarem Fehlverhalten, wozu zweifellos mein gelöschtes Pferdematerial gehörte, galt die alles umfassende Standardausrede, dass wir ja viel zu wenig Geld bekämen und viel zu viel Überstunden leisten müssten und der ganze Laden ein Ausbeuterparadies erster Güte sei. Drastische Pannen könnten unter den bei uns herrschenden Bedingungen nicht grundsätzlich vermieden werden. In der Livesendung gab es manchmal falsche Einblendungen, falsche Beiträge oder falsche Blueboxbilder. Aber meistens klappte es am frühen Abend eine fertige und fehlerfreie Sendung live in das Kabelnetz einzuspeisen, obwohl wir ein zusammengewürfelter Haufen von Praktikanten und Quereinsteigern waren. Jeder hatte seinen Stolz und wollte seine Aufgaben, erfolgreich erledigen. Wir fanden unsere Sendung schwachsinnig, die Zuschauer doof und der Chef löste manche Hassattacke bei uns aus. Trotzdem kamen wir pünktlich und arbeiteten am Abend, bis alles Notwendige erledigt war.
Mir genehmigte der Chef nach drei Monaten die erste Gehaltserhöhung, die mich von einem niedrigen auf einen mittleren Praktikantenlohn anhob. Maria ging nach dem Ende der Semesterferien zurück in die Universität, aber weil es bei uns viel zu tun gab, machte sie im Nebenjob als Reporterin weiter. Wenn wir beide zum Dreh fuhren, waren wir ein eingespieltes Team, auch wenn wir keine Versuche mehr unternahmen, die Freizeit gemeinsam zu verbringen. Weder Pferdemädchengrillpartys noch Kaffeetrinken in meinem Lieblings-Alternativcafé für Systemkritiker. Nur einmal genehmigten wir uns eine gemeinsame Flasche Wein. Es war wieder ein Wochenende, diesmal ein Sonntag, an dem wir gemeinsam drehen mussten. Es ging um den stärksten Mann der Welt, der für einen wohltätigen Zweck auf einem Volksfest ein ganzes Kinderkarussell hochheben wollte. Der Erlös sollte dem Kindergarten in dem Stadtteil, der als sozialer Brennpunkt galt, zugute kommen. Es war zu erwarten, dass wir das schnell erledigten. Wenn die Einsätze nicht lange dauerten, kamen sie mir manchmal vor wie ein Familienausflug. Zuvor saß ich zu Hause, wir tranken im Hof Kaffee: Gitarren-Hans, Tina und die blonde Bedienung, die zu dem Zeitpunkt immer noch meine Geliebte war. Dann klingelte das Telefon. Diejenigen, die meistens anriefen, waren alle da. Als ich zum Telefon ging, dachte ich, es sei bestimmt Maria, die mir irgendeine Terminänderung mitteilen wollte, aber sie war es auch nicht, sondern Martin. Der hatte nichts mehr von sich hören lassen, seit er damals auf der Party an der Löschung des Videomaterials beteiligt gewesen war, es herrschte Funkstille zwischen uns beiden. Abends, nach der Arbeit, hatte ich ihm damals schwere Vorwürfe auf den Anrufbeantworter gesprochen. Letztendlich kam ich zu der Einsicht, dass ich selbst schuld gewesen sei. Als Kameramann hat man auf die Kamera aufzupassen, auf das gefilmte Material ebenfalls. Aber Martin hätte sich durchaus entschuldigen können. Wenn er sich entschuldigt hätte, hätte ich ihm gesagt, dass ich es nicht mehr schlimm fand und es sowieso keinen nennenswerten Schaden angerichtet hatte.
Als er dann an jenem Samstag anrief und mir sagte, dass der falsche Film weg sei, wusste ich erst gar nicht, was er mir sagen wollte, denn so, wie ich es verstand, ging es darum, dass mein Super-8-Film „Der falsche Mann zur falschen Zeit im richtigen Film“ verlorengegangen sei und das konnte nicht sein, der Film war ein Unikat, es gab ihn nur als einzelnes Exemplar, es existierte nicht einmal eine schlechte Videokopie und er war erst zwei Mal in der Öffentlichkeit gezeigt worden, bei der Premiere und in unserer Scheune. Wenn er verschwunden wäre, gäbe es ihn nicht mehr und das wäre eine absolute Katastrophe, doch je länger ich auf Martin einredete und ihn fragte, ob das ein Witz sei, ob er mich verarschen wolle oder das Verschwinden des Filmes als Kunsthappening oder Performance zu inszenieren beabsichtige, desto klarer wurde, dass ihm der Film schlicht und ergreifend in der U-Bahn gestohlen worden war.
Die ganze Tüte sei entwendet worden, in der sich leider auch noch unglaublich wichtige Disketten befunden hätten, wobei ich mir gar nicht vorstellen konnte, was auf diesen Disketten hätte gewesen sein können, damit sie auch nur halb so wichtig wie mein unwiederbringlicher, unersetzlicher falscher Film waren. Digitaler Kram kann doch einfach noch einmal kopiert werden, aber mein Film, der darf nicht weg sein, maulte ich Martin durchs Telefon an und er gab zu, dass die Disketten Daten enthielten, die er sträflicher weise nirgends gesichert hätte, da sei ihm jede Menge Arbeit verlorengegangen, die er dann ganz schnell, in durchgemachten Nächten, nochmal reinstecken musste, um seine Semesterarbeit zu retten, aber gleichzeitig sei er ja auch zur Polizei und zum Fundamt gerannt und habe alles probiert, alle verrückt gemacht, wegen seiner geklauten Aldiplastiktüte. Ja, es sei tatsächlich eine banale Aldiplastiktüte gewesen, die ihm gestohlen worden sei, aber ohne Whiskey, Wein oder Zigaretten, nur ein paar Bücher und eine Jacke für den Abend und, wie gesagt, der Film und die Disketten. Ich solle mir nicht vorstellen, dass er die Aldiplastiktüte flaschenklappernd durch die U-Bahn getragen hätte, da würde man die Diebe anlocken wie das Licht die Motten, es sei wirklich keine Fahrlässigkeit gewesen. Er wäre auf dem Weg zu einem total engagierten Hinterhofkino gewesen, wo er schon zwei Mal mit dem Programmdirektor gesprochen habe wegen dem falschen Film und jetzt hätten sie sich den Film anschauen wollen, aber da war plötzlich die Tüte weg. Einfach verschwunden! Da war auch ein Musiker in der U-Bahn, vielleicht hatte der ihn abgelenkt, vielleicht auch nicht, es sei ihm ein Rätsel, wie das habe passieren können und er entschuldige sich, obwohl er wüsste, dass es dafür keine Entschuldigung gab. Er halte es ja selbst für einen entsetzlichen Verlust und dann sei er verdattert vor dem Programmdirektor gestanden, der ja eigentlich auch nur ein erfolgloser Filmemacher sei und habe sagen müssen, dass er den Film soeben verloren habe, was den Programmdirektor fast zu Tränen gerührt habe. Er habe gefragt, ob es eine Kopie gäbe und Martin antwortete nein und er habe gefragt, ob es eine Videoabtastung gäbe und Martin sagte wieder nein, also sei es das alleinige Original und Martin sagte ja und da empfände er natürlich ein wahnsinniges Mitgefühl mit ihm, und sie bekamen einen riesen Hass auf diese Junkies, die überall alles wegklauten, nur um ihre dreckigen Drogen zu bezahlen und das Verheerende sei ja, dass so ein Junkie, aber auch jeder andere Dieb überhaupt keinen Nutzen von so einer Super-8-Spule mit dem tollen Film habe, der schmeißt das ja bestimmt in den nächsten Mülleimer oder in die Spree. Es sei denn, er versucht, ihn auf dem Flohmarkt zu verkaufen, dann könnte der Film vielleicht wieder auftauchen, oder gerät an einen Sammler, vielleicht sogar einen Produzenten.
Martin verstummte, ich fragte: Und jetzt? Er antwortete, er hätte schon alles versucht, aber er würde auch weiterhin alles versuchen, nochmal zum Fundbüro gehen oder nochmal zur Polizei und auch zum Flohmarkt und schauen, ob jemand meinen Film anbiete, er kenne da ein paar Händler, aber, das müsse er gestehen, die Chancen seien so gut wie Null Komma null null null. Da gab ich ihm Recht. Der Film war futsch und Martin ein Idiot. Das sagte ich ihm und haute den Hörer hin. Die anderen hatten aufgrund meiner erregten Antworten schon verstanden, dass irgendwas Schlimmes passiert sei, aber ich musste los, ich warf ihnen nur ein paar Halbsätze hin, der Film sei verlorengegangen, durch Martins Schuld. Im Gehen schnappte ich mir Jacke und die Mütze und fuhr mit dem klapprigen Kleinbus davon. Unterwegs regte ich mich über Martin auf, dann lud ich Maria ein. Sie musste sich alles anhören, meinen Ärger, meine Wut und alles Negative, was mir zu Martin einfiel. Jetzt band ich Maria auch auf die Nase, dass vermutlich Martin die Hauptschuld daran trug, dass das wahnsinnig gute Material vom Reitturnier, das ich ihr zuliebe mit besonders viel Mühe gedreht hatte, verlorengegangen sei. In meiner Erregung drehte ich mir alles so zurecht, wie ich es gerade brauchte. Es ging nur darum, meine Wut zu rechtfertigen. Martin war weit weg, Maria ganz nah und eine geduldige Zuhörerin. Ich nutzte die Gelegenheit und entschuldigte mich bei ihr dafür, dass ich die Vorwürfe des Chefs damals auf ihr sitzen ließ und schon schimpfte ich weiter über Martin, den Blödmann.
Wir erreichten das Stadtteilkinderfest genau zur richtigen Zeit, denn der stärkste Mann der Welt fing seinen Rekordversuch genau in dem Moment an, als ich die Kamera drehfertig in die Stativplatte einrastete. Er, ein mehrfacher Olympiamedaillengewinner, stieg auf das hohe Podest, warf sich riesige Gurte über die Schulter und zog dann das Karussell mit den 12 Kindern, was summa summarum 462 kg Gewicht ergab, für 30 Sekunden ein paar Zentimeter nach oben, so dass es sich einmal im Kreis drehte, die Kinder jubelten, dann stieß er ein gigantisches Stöhnen aus und setzte das Karussell wieder ab. Die Zuschauer klatschten, irgendein Sponsor übergab der Kindergartenchefin den Scheck über 4.620 Deutsche Mark, wir interviewten den Gewichtheber, fertig. Das alles bei fantastischem Herbstwetter mit einem dunkelblauen Himmel zwischen großen Bäumen, deren Blätter in einem kräftigen Grün leuchteten.
Beim Einladen der Technik wurden wir daran erinnert, dass wir eine Kiste mit Weinflaschen im Wagen hatten, die uns ein Werbekunde bereits einige Tage vorher mitgegeben hatte, aber weil wir beim Ausladen immer die Hände mit der Kameratechnik voll hatten, war sie im Auto geblieben. Wir nahmen uns eine Flasche, holten uns vom Kinderfest Pappbecher und spazierten dann am Parkplatz vorbei zu einer kleinen Wiese mit Grillplatz, von der man einen wunderbaren Blick auf die Stadt hatte, die vor uns im Tal lag. An den Hängen des Tals die Weinberge, aus denen der Wein stammte, den ich gerade entkorkte. Maria und ich ließen den Blick über die Stadt schweifen und redeten über die vielen Orte, an denen wir schon gedreht hatten. Mir fiel beim Blick auf die Stadt zum ersten Mal auf, wie unglaublich viele Kirchtürme zwischen den Häusern in die Höhe strebten. Aber wir befanden uns noch weiter oben, an der Kante, wo der Hang des Tales in die Ebene übergeht. Ich fand, dass Maria an dem Tag besonders gut aussah und besonders nett zu mir war. Wir saßen nebeneinander, wegen des Blicks in das Tal. Nachdem wir mehrmals nachgeschenkt und die Weinflasche geleert hatten, waren wir soweit zueinander gerückt, dass wir uns berührten. Damit war allerdings der Höhepunkt an Intimität zwischen uns erreicht, nicht nur in Bezug auf diesen Tag. Wir brachen auf, um die Technik ins Studio zu bringen, von dort wollte sie zu Fuß in ein Café gehen, wo ihr Freund auf sie warten würde. Ich fuhr aufs Dorf und zu Hause nahm ich noch eine Flasche aus dem Auto, trank sie mit Tina und am Abend blieb ich lang in der Kneipe, in der meine Geliebte hinter der Bar stand. Der Abend war ruhig, ein Sonntagabend eben, aber ein paar Gäste waren dann doch so hartnäckig, dass ich den Thekenschluss nicht schaffte und allein mit dem Fahrrad nach Hause fuhr.
Am nächsten Morgen wäre ich gern liegen geblieben. Mit der Hoffnung, es könnte ein ruhiger Tag werden, fuhr ich zur Arbeit. Dort empfing mich Maria hektisch mit der Neuigkeit, dass der heilige Liborius wieder aufgetaucht sei, aber niemand wusste, wo er war. Zwar gab es ein Fax der Polizei, in dem mitgeteilt wurde, die Reliquie sei in einer Kirche gefunden und zur Polizei gebracht worden, aber als wir sie filmen wollten, hieß es, die Reliquie sei nicht, oder nicht mehr im Polizeipräsidium. Auch im Dom und bei der Kirchenverwaltung wusste zunächst niemand Bescheid. Schließlich stellte sich heraus, dass sich die Reliquie bei einem Goldschmied befand, der sie im Auftrag der Kirche überprüfen und reinigen sollte. Da zog mich Maria hinter sich her, damit wir die ersten seien, die den verschwundenen Liborius vor die Linse bekämen mitsamt einem Statement des offiziellen Bistumsgoldschmiedes. Der war auch ganz aufgekratzt, aber empfing uns freundlich, denn es war ja ein Glückstag! Nicht nur für ihn, sondern für alle Bürger der ganzen Stadt, weil nun die Reliquie zurückgekehrt sei, weil der Dieb durch die Gebete der Gläubigen seiner Verfehlung bewusst und reumütig geworden sei und das Reliquiar in einer Plastiktüte in einer Stadtteilkirche abgelegt hätte, genaugenommen soll es eine Aldiplastiktüte gewesen sein, fügte der Goldschmied hinzu und erging sich, ohne eine Zwischenfrage zuzulassen, in einer langen Ausführung über das fromme Leben und das Leiden des seligen Liborius, der den Peinigungen seiner Widersacher mit Gottesfurcht und Standhaftigkeit entgegengetreten sei, dessen Rückenwirbel zum Zeichen der Standhaftigkeit in Perlen, Diamanten und Gold gefasst seien, vielleicht aber auch in etwas anderem, denn es folgten unglaublich viele Details, die ich mir nicht merken konnte und die, wie ich dem Zählwerk meiner Kamera entnehmen konnte, stolze 11 Minuten lang waren. Er beendete seine Rede mit der Aussage, er selbst sei der festen Überzeugung, dass für das Wiederauffinden der Reliquie der starke Glaube der Gemeindemitglieder und die Standhaftigkeit des Heiligen ausschlaggebend waren. Nun wusste ich also, woran es mir mangelte.
Medialismus, Teil 1: Super-8
Teil 2 ___ Teil 3 ___ Teil 4 ____ Teil 5
1
Eine leere Werbefläche, wie man sie von überall kennt, aus Dörfern, Städten, von Landstraßen oder sogar aus leblosen Industriegebieten, die üblichen 10 qm, von denen uns normalerweise freundliche Gesichter anlachen, die sich mit einem Konsumprodukt verbündet haben, um es den Passanten, Fahrrad-, Bus- und Autofahrern zu empfehlen. Aber in diesem Fall war die Werbefläche inhaltslos, frisch mit weißem Papier beklebt und ich stand davor, kurz nach Mitternacht. Das ist der Anfang der Geschichte, denn ich wollte die Fläche bemalen, aber ich traute mich nicht, obwohl weit und breit niemand zu sehen war und die wenigen Autos kündigten sich durch ihre Scheinwerfer schon von weitem an. Leider verplemperte ich viel Zeit damit, es NICHT zu tun. Das hätte viel schneller gehen können, aber nein, zu lange stand ich vor der weißen Wand, trug die Faserschreiber in der Tasche, befühlte sie, dachte an die Worte, die ich hätte schreiben können, oder die Bilder, die ich hätte malen können, an die Reaktionen der Freunde oder die Reaktionen der Feinde, schwankte hin und her, verlor den Faden und ging schließlich bis an die Straßenecke, kehrte dann aber nochmal zurück, holte endlich einen Stift aus meiner Umhängetasche, von dem ich die Abdeckkappe herunterzog, dachte schon an den ersten Strich, aber die Kappe fiel mir auf den Boden, ich musste sie suchen. Während ich am Boden herumkroch, reifte der Entschluss, mich aus meiner mir selbst gestellten Aufgabe zurückzuziehen. Was bedeutete, dass ich nach Hause ging und bei meinem einsamen Spaziergang durch die ziemlich leblose Universitätsstadt umso lebhafter darüber phantasierte, wie bedeutsam es gewesen wäre, die Werbefläche in meinem Sinn zu gestalten, den Werbeflächenzweck zu invertieren, den Konsumgedanken zu negieren, etwas Kritisches zu formulieren. Etwas Aufrüttelndes. Eine Anti-These zur Heile-Welt-Darstellung der Werbebotschaften. Natürlich total originell. Aber letztendlich fiel mir nichts ein, was meinem eigenen Anspruch genügte, alle Ideen blieben stecken, sobald ich sie zu Ende dachte. Wenn ich etwas hingemalt oder hingeschrieben hätte, sollte es zumindest tiefsinnig und künstlerisch wertvoll sein, Selbstbestätigung wünschte ich mir, Selbstbefriedung wurde es, denn die endlose Kette der Gedanken, die zu nichts führte als zu der Einsicht, dass ich zu zaghaft, zu unentschlossen, zu unspontan sei und versagt hatte, ließ sich nur durch erotische Hirngespinste abwürgen, welche wiederum einen Samenerguss verursachten. Was mich emotional nicht weiter berührte, damals onanierte ich häufig, später auch.
Am Abend des Tages, der auf die Nacht folgte, in der ich meine Zeit an der leeren Werbefläche verplempert hatte, saß unerwartet eine unbekannte Blondine in der WG-Küche. Sowas kam bei uns nicht allzu oft vor. Da meine Vorlesung erst um zehn Uhr begonnen hatte, war ich halbwegs ausgeschlafen. Am späten Nachmittag war ich mit Holger, dem Lehramtsstudenten in der Küche gesessen, wir hatten Brote gegessen und uns über Alltäglichkeiten unterhalten. Danach gingen wir in unsere jeweiligen Zimmer um für das jeweilige Studium zu lernen. In den anderen Zimmern saß eventuell auch noch jemand. Da alle ihre Zimmertüren geschlossen hielten, war meist nicht ohne weiteres erkennbar, wer zu Hause war, und wer nicht. Ich beschäftigte mich damals ausgiebig mit Differenzialrechnung, weil es der Lehrplan so vorsah und es waren innerhalb der nächsten Tage Übungsaufgaben abzugeben. Als es mir gerade so schien, als hätte ich das entscheidende Problem der Aufgabe gelöst und ich könnte nun mit aufwändiger, aber vorhersehbarer Methodik ins mathematische Ziel schlittern, wollte ich mir in der Küche ein Glas mit Wein füllen. Den Übergang von der harten Gedankenarbeit zur Abendentspannung einläuten. Das war der Moment, als ich dort die Blondine mit dem Rücken zur Tür sitzen sah. Ausnahmsweise reagierte ich angemessen, sagte beiläufig hallo, nahm mir den Wein aus meinem Regal, blickte sie auch von vorne an. Vom Regal her kommend hatte ich die bessere Position. Von vorne gefiel sie mir nicht so gut, denn ihr Gesicht war etwas kantig und grob, die Lippen schmal. Von hinten hatte ich mir mehr erwartet. Die Bluse mit den großen Punkten fand ich gut, die halblangen glatten Haare auch, aber der Gesamteindruck lief, wie ich es in Gedanken formulierte, auf gehobene, sehr gehobene Mittelklasse hinaus. Sie nahm das angebotene Glas Wein von mir, ich setzte mich an den Tisch und dann plauderten wir ungezwungen. Sie war mit meiner Mitbewohnerin, der Geografiestudentin gekommen und die Geografin wollte noch duschen und sich aufhübschen, bevor die beiden dann gemeinsam zu einem Kunstfilmabend gehen würden, und deshalb saß die blonde Sabine mit dem kantigen Gesicht allein in der WG-Küche. Kurzfilmabend, das war mein Spezialgebiet, denn ich hatte mir ja inzwischen einen Namen als Super-8-Aktivist gemacht, aber nein, sie sagte ja Kunstfilm, war das überhaupt ein definierter Begriff? Es seien wohl Kurzfilme mit künstlerischem Inhalt, die im Spätprogramm des Videofestivals laufen sollten. Video? Ja, das gab es auch schon. Man könnte vermuten, dass Super-8-Filmemacher Videotechnik mögen, was aber in meinem Bekanntenkreis nicht der Fall war, es handelte sich eher um eine unbegründet verbissene Feindschaft. Super-8 war die Sparversion des ehrwürdigen Kinofilmes, Video das Handwerkszeug des Fernsehens, speziell des damals noch neuen Privatfernsehens, das alle Intellektuellen ungesehen verachteten. An ideologisch motivierter Polemik mangelte es nicht. Vielleicht ahnten die Super-8-Aktivisten damals schon, dass die Zeit gegen sie arbeitete und sträubten sich trotzdem gegen den Fortschritt, kompensierten ihren Wichtigkeitsmangel mit markigen Sprüchen wie „Alle Macht für Super Acht!“. Mit Sabine unterhielt ich mich angeregt über die Kontroverse, oder vielmehr textete ich sie mit meinem Spezialwissen zu und sie zeigte Interesse an meinen provokanten Thesen, mit denen ich mich gegenüber der videologischen Ideologie abgrenzte. Videologische Ideologie gab es vermutlich weder als Begriff, noch als Ideologie, aber ich tat so, als handele es sich um einen etablierten Fachausdruck. Am liebsten hätte ich ihr sogar einen Vorwurf daraus gemacht, dass sie zum Videofestival ging. Das verkniff ich mir, sondern beschränkte mich darauf, die künstlerische Überlegenheit filmischer Produktionsweisen auf filmischem Material zu erläutern. Sie nippte am Wein und hörte aufmerksam zu, vermutlich hatte sie darüber überhaupt noch nie nachgedacht, warum auch, sie war ja Geografin, so wie meine Mitbewohnerin, sie kannten sich aus dem Studium. Dann kam die Mitbewohnerin frisch geduscht und ausgehfertig in die Küche. Zu ihr hatte ich kein so gutes Verhältnis wie zu den anderen, sie nahm weniger intensiv am WG-Leben teil. Aber ihre Freundin Sabine brachte das Gespräch gleich in die richtige Richtung, denn sie beschwerte sich bei meiner Mitbewohnerin, dass sie ihr gar nicht gesagt hätte, dass ich Filmemacher sei. Meine Mitbewohnerin fragte daraufhin, ob ich nicht zum Videofestival mitkommen wolle. Nun saß ich in der Falle, denn da ich vorher gegenüber Sabine so ausführlich über die ästhetische Minderwertigkeit von Video schwadroniert hatte, musste ich jetzt, um Würde zu bewahren, darauf verzichten, mir die künstlerischen Kurzfilme beziehungsweise die kurzen Kunstfilme anzusehen. Meine geografisch bewanderte Mitbewohnerin versäumte nicht, mich zum Abschied mit der Aussage zu quälen, dass sie immer gedacht hätte, es sei egal, ob man mit Film oder mit Video dreht. Aber Sabine machte das wieder wett, sie forderte mich auf, Bescheid zu geben, wenn meine Filme mal irgendwo zu sehen seien. Das war gut. So musste ich gar nicht aufdringlich sein, um sie zu einem Wiedersehen anzuregen. Dann verschwanden die beiden und ich kümmerte mich, wie ursprüngliche geplant, um meine Mathematik-Übungsaufgaben.
2
Es vergingen ein paar Wochen. Meine Geografie studierende Mitbewohnerin traf ich nur selten in der Küche oder auf dem langen Flur unserer WG, und als wir uns über den Weg liefen, entwickelte sich kein Gespräch. Sie interessierte sich weder für meine künstlerischen noch für meine geschlechtlichen Ambitionen. Deshalb verzichtete ich darauf, mit ihr einen Austausch an Informationen bezüglich ihrer Freundin Sabine anzuregen. Unterdessen arbeitete ich an der Fertigstellung meines neuesten Super-8-Filmes, was bedeutete, dass ich verschiedene Geräusche zusammensammelte und mit Hilfe des Projektors auf den Film überspielte. Oder die Schauspieler die Dialoge synchron einsprechen ließ, Satz für Satz. Der Film hieß „Die Rückbesinnung“, ein zehnminütiges Werk. Es sollte, wie man anhand des Titels vermuten konnte, um Identitätssuche, Identitätsverwirrung, Identitätsfindung gehen. Man musste viel guten Willen aufbringen, um das nachzuvollziehen, denn eigentlich trieben sich nur drei vermeintlich coole Typen auf einem Kinderspielplatz herum und quatschten dummes Zeug, welche Kneipe warum und für welchen Daseinszustand angesagt sei, welche Form von Alkoholexzess das Sozialprestige steigert und welcher nicht. Die drei Schauspieler, die ja gar keine professionellen Schauspieler waren, sondern aus meinem Bekanntenkreis stammten, brachten das Absurde auf dem Spielplatz ganz gut rüber und es waren ein paar echte Kinder dazwischen geschnitten, auf der Wippe und beim Ballspielen, so dass die Dialoge immer wieder heitere Unterbrechungen bekamen und der Film, wie sich später herausstellte, den Zuschauern ganz gut gefiel. Meine Geografie studierende Mitbewohnerin sagte, dass sie bei der Premiere keine Zeit habe und machte noch eine kritische Bemerkung über den Titel, den sie blöde fände, ich solle doch nicht immer so rückwärtsgewandt sein. Aber trotzdem überbrachte sie auf meine Aufforderung hin eine Einladung an Sabine. Genaugenommen ein Flugblatt, so ein vervielfältigter DIN-A5-Zettel, mit Schreibmaschinenbuchstaben und dem ziemlich kontrastschwachen Bild einer leeren Kinderschaukel. Die verschiedenen Schriftgrößen erzeugte ich durch Vergrößerung im Copyshop, dann mit den vergrößerten Worten wieder nach Hause, wo die einzelnen Text- und Bildfragmente zusammenklebt wurden und diese Vorlage wurde schließlich wiederum im Copyshop vervielfältigt.
Mein guter Freund Martin bewohnte allein eine Vierzimmerwohnung, die immer wieder für Partys und Treffen genutzt wurde. Dort sollte die Premiere des Filmes stattfinden. Wir versuchten, so zu tun, als sei das nichts Besonderes, aber natürlich war es das. So ein Film, den man mit Super-8 dreht und dann vertont und es spielen auch noch drei coole Szene-Typen mit, das war nicht alltäglich. Damals gab es noch kein YouTube, wo inzwischen jeden Tag unglaublich viele Filmminuten hochgeladen werden, vermutlich mehr, als damals in der ganzen Bundesrepublik im ganzen Jahr auf Schmalfilm entstand. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass es damals aufgrund des geringeren technischen Entwicklungsstandes besser gewesen sei, aber es war exklusiver. Außerdem war es gut, weil Sabine kam und weil mein Freund Martin diese Vierzimmerwohnung unter dem Dach mit großem Balkon hatte. Es war ein altes, kleines Haus in einer Gasse. In den unteren Stockwerken waren Lagerräume untergebracht waren, so dass weder unsere alltäglichen Unternehmungen noch unsere nächtlichen Ausschweifungen jemanden störten. Martin half mir gerne bei meinen Filmen und er kannte sich mit Fotoapparaten aus und hatte zuhause eine Dunkelkammer. Manchmal saßen wir bei ihm herum, es wurden Fotos gemacht und während die Gäste auf dem Balkon kifften, entwickelte er den Film und macht Abzüge, die er dann zum trocken an die Wäscheleine hing. Damals war er gerade Zivildienstleistender, hatte relativ viel Zeit und ihm war es durchaus recht, wenn ich einen Anlass zum Trinken oder Betrinken lieferte. Außerdem war er einer der drei Schauspieler. Ich saß schon am Nachmittag bei ihm im Wohnzimmer, wir unterhielten uns darüber, was wir als nächstes Filmprojekt in Angriff nehmen könnten, schweiften aber ab, denn er gestand, dass er beim Videofestival gewesen war, vermutlich sogar in der gleichen Vorstellung wie Sabine und meine Mitbewohnerin. Es wunderte mich ein bisschen, denn in den Tagen, als das Videofestival stattfand, hatten wir uns mehrmals getroffen und ich glaubte mich zu erinnern, dass es unser Konsens war, keine Vorstellung zu besuchen. Als ich aber genauer darüber nachdachte, schien es mir plötzlich, als sei es immer nur ich gewesen, der beteuerte, das wir nicht hinwollten, als hätte Martin gar nicht zugestimmt. Er hatte einfach geschwiegen und gemacht, was er wollte. Das ist doch egal, sagte ich mir, aber das war es mir nicht. Martin erzählte von einem Spiegel-Effekt, den er in einem Video gesehen hätte und der ihn beeindruckte. Technische Spielerei, entgegnete ich in einem Tonfall, der ihm das Wort abschnitt, er wechselte das Thema. Eigentlich hätte ich gern noch mehr erfahren, aber neugierig wollte ich nicht erscheinen. Jetzt hatte ich mich schon wieder selbst ausgegrenzt und gerade da klingelte es, obwohl die Party erst in zwei Stunden beginnen sollte. Martin ging zur Haustür hinunter und kam tatsächlich mit Sabine zurück. Ihre Haare waren verändert, aber ich konnte nicht sagen, wie. Sie gefiel mir besser als beim letzten Treffen, sie gefiel mir richtig gut. Außerdem freute ich mich, dass sie schon da war. Das Warten auf den ersten Gast kann manchmal ganz schön quälend sein. Oder wenn der erste Gast ein Schwätzer ist. Aber Sabine kam mir gerade recht. Sie berührte mich bei der Begrüßung dezent an der Schulter und setzte sich neben mir auf den Boden. Ob ich aufgeregt sei, fragte sie, und da tat ich ganz cool, nein, ich bin nicht nervös, so ein Film läuft einfach, da kann ja nichts schiefgehen. Na, aber wenn es den Leuten nicht gefällt? Es gefällt ihnen aber, da bin ich mir sicher! Bei einer Premiere wird nicht der Film, sondern es werden die Zuschauer selektiert. Die gehören ja alle irgendwie dazu oder haben das Bedürfnis, dazuzugehören, zur Premierenkultur-Subkultur-Filmemacher-Klüngel-Clique – und wenn sie das nicht wollen würden, dann wären sie gar nicht da. Und damit sie zuhause nicht erzählen müssen, dass die Party langweilig und der Film schwachsinnig war, da finden sie es eben gut, zumindest teilweise gut. Ein paar Lästermäuler gibt es dann natürlich schon, die ihre Rolle darin finden, dass sie alles besser wissen und besser gemacht hätten, zu denen gehörte ich ja selbst. Wenn ich bei Premieren anderer Filmemacher zeigen wollte, dass ich einer von denen bin, die eine Ahnung haben, dann erging ich mich in tiefsinnigen Analysen und kritischen Kommentaren.
So geschwollen redete ich auf sie ein. Mir schien, als beeindruckte ich sie. Martin drehte unterdessen einen Joint, so dass wir, nachdem ich meine Ausführungen beendet hatte, erst einmal gar nicht viel sagten, sondern uns der bedächtigen Einnahme von THC hingaben. Die Kifferei interessierte mich damals kaum, aber bei Martin und vielen meiner Freunde gehörte es zur Freizeitgestaltung dazu, und es passte auch so schön in seine Wohnung, wo ein paar Matratzen auf dem Boden lagen, wo immer mal jemand spontan vorbeikam, wo wir dumme Ideen hatten, und oft gleich umsetzten. Rauchen, Trinken, Kiffen gehörte zu der spartanischen Gemütlichkeit, die die groben, dunklen Holzbohlen des Fußbodens ausstrahlten. Die tiefstehende Sonne schien durch ein Band niedriger Fenster ins Wohnzimmer und warf die Schatten der Fensterkreuze auf uns. Jetzt saß Sabine plötzlich so im Gegenlicht, das sich ihr BH ganz deutlich unter der Bluse abzeichnete. Sie war doch ziemlich sexy. Aber sie begann sich mit Martin über die Wohnung zu unterhalten, was sie kosten würde, und über WG-Probleme, Zimmerprobleme, Mitbewohnerprobleme. Da hätte sie eigentlich viel besser mit mir drüber reden können, ich wohnte in einer Sechs-Personen-WG, sogar mit ihrer Freundin zusammen, aber vermutlich merkte sie, dass ich das Thema nicht leiden konnte. Ich war der Filmemacher, hatte meine schlaue Rede über Filmpremieren gehalten, Martin war der Vierzimmerwohnungs-Bewohner, er durfte über Wohnungen reden. Jedem sein Gesprächsthema zum Wohlfühlen, außerdem dauerte es nicht lang, da klingelte es, Martin ging wieder runter zur Haustür und Sabine stand auf, um nochmal Teewasser aufzusetzen. Als sie sich erhob, erschienen mir ihre Beine viel zu lang, oder lag es daran, dass ihre Jeans nicht richtig saß. Das Gegenlicht der untergehenden Sonne war jetzt weg und damit auch der reizvolle Einblick. Auch ich stand auf und sagte, dass ich nochmal den Filmprojektor überprüfen wolle. Da es inzwischen dämmrig im Zimmer geworden war, ließ sich das Bild besser justieren und beurteilen. Währenddessen kam Martin mit drei weiteren Gästen zurück, die ich nur vom Sehen kannte. Es ging also los und ich spürte mit einem Mal eine deutliche Nervosität. Am Projektor war alles in Ordnung, das hatten wir als allererstes sorgfältig eingerichtet. Ich ging also in die Küche und verteilte Salzstangen in Gläsern und Chips in Schalen. Mit den Gläsern und den Schalen ging ich auf umständlichen Wegen durch die Wohnung. Martins Wohnung war verwinkelt und unübersichtlich. Lauter kleine Kämmerchen, die das Wohnzimmer umgaben, das alles mit Zwischentüren, Dachschrägen und Erkern, sogar das Badezimmer hatte zwei Türen, einen Eingang und einen Ausgang. Dadurch konnte ich aus drei verschiedenen Türen ins Wohnzimmer treten, und während ich durch die Wohnung streifte und die Salzstangengläschen verteilte, hörte ich immer wieder Sabines Lachen. Sie lachte ganz schön laut. Wenn ich dann durch eine der drei Türen ins Wohnzimmer trat, konnte ich nicht feststellen, um was es ging, warum gelacht wurde, alle saßen auf dem Boden und sahen so aus, als ob sie gar nichts zu lachen hätten. Ich tat aber uninteressiert, zog mich unauffällig in die Küche zurück, nahm die nächsten zwei Salzstangengläser und verteilte sie über die Route, die durch das Badezimmer in die Kämmerchen führte und dann wieder über das Wohnzimmer zurück in die Küche. Sabine lachte immer wieder, aber nur, wenn ich nicht mitbekommen konnte, um was es ging. War sie etwa eine von denen, die beim Kiffen lustig wurde? Oder machten sie Witze, die ich nicht verstand? Verstehen sollte? Oder etwa Witze über mich? Es blieb bei Vermutungen, denn plötzlich war die Ruhe vorbei. Meine WG-Kumpels kamen, und hinter ihnen einige aufgeregten Frauen, die zu Achim und Rainer gehörten, die anderen beiden Hauptdarsteller. Achim studierte damals Theaterwissenschaften und hatte eine ganze große Klappe. Er wusste immer über alles Bescheid. Weil er nicht nur Theater-, sondern auch Filmexperte war und sein Expertentum darin gipfelte, dass er Super-8 grundsätzlich für super und meine filmischen Werke erst recht für super-super hielt, ergab sich zwangsläufig, dass er auch einmal in einem meiner Filme mitspielen musste. Rainer wiederum, der dritte Schauspieler spielte Schlagzeug in einer Nachwuchsband, die wegen ihren vielen Besetzungswechsel nie über lokale Berühmtheit hinauskam.
Martin ließ jetzt die Haustür offen stehen, so dass die weiteren Gäste einfach von der Straße reinkommen konnten und drehte die Musik lauter. Ich hatte keine Chance mehr zu hören, ob und was über mich gelästert wurde. Meine WG-Kumpels bestätigten nochmals, dass unsere Geografie-Mitbewohnerin nicht kommen könne, worauf ich entgegnete, dass mich das nicht störe, da ich mich von ihr meist missverstanden fühle. Wer wen missversteht, beschäftigte uns eine ganze Weile, während der Raum sich füllte, Flaschen entkorkt und Schallplatten gewechselt wurden. Speziell die ankommenden Frauen hatten wir gut im Blick, machten dumme Bemerkungen über sie, bis ich irgendwann bemerkte, dass Sabine gar nicht mehr dort saß, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. Erschreckt schaute ich mich um, da kam aber gerade ein neuer Trupp frischer Gäste, der mich in Anspruch nahm, einer nach dem anderen quatschte mich voll und die Forderung, dass der Film gestartet werden solle, wurde immer häufiger gestellt. Wo war Martin, wo hatte ich die Weinflasche hingestellt, man kam fast nicht mehr durch die dicht stehenden Menschen hindurch, aber als ich laut rief, hörten sie alle auf mich, schließlich war ich der Filmemacher. Auch Martin bemerkte mich schließlich und schaltete die Musik aus. Leute, jetzt ist es gleich soweit, sagte ich laut, aber da kam auch schon ein Zwischenruf, Heike sei noch nicht da, sie käme sofort, ich solle noch warten. Heike? War das die große Schlanke? Oder die Blonde mit den auffälligen Lidschatten? Oder keine von beiden? Im Film hatte sie nicht mitgespielt, aber wenn es die Große war, würde ich vielleicht warten, aber da rief Martin, dass wir trotzdem jetzt sofort anfingen, weil wir den Film später nochmal zeigen können. Stimmt, das hatten wir ausgemacht, also drängte ich mich an den Projektor und fand dort einen Platz, Licht aus, rief ich und Martin drückte den Schalter einer Mehrfachsteckdose, an der alle Lampen angeschlossen waren, so dass es wirklich schlagartig dunkel wurde. Sofort begann das Knattern des Projektorlaufwerks. Ich legte die Hand an das Objektiv, um die Schärfe bei Bedarf sofort nachziehen zu können, aber sie stimmte und ich brauchte nicht zu korrigieren. Und da sahen sie alle auch schon die erste Szene, in der Martin unvermittelt direkt in die Kamera hinein sagt: „Ich weiß gar nicht, warum ihr hier seid, wenn ihr was Besseres geplant hattet!“ Dabei raucht er und dann schnipst er seine Zigarettenkippe supercool direkt an der Kamera vorbei und zieht die Mundwinkel hoch, mir gefiel das gut und auch die Zuschauer, zumindest diejenigen, die Martin kannten, fanden es prima. Es war nicht zum Lachen, nur zum Schmunzeln. Ich merkte, dass es beim Publikum funktionierte. Jetzt waren sie gut eingestimmt und würden die etwas langatmige Anfangsszene gut gelaunt überstehen. Mein Weinglas war wieder verschwunden, aber da stand eine Flasche unter dem Projektortisch, Martin hatte dort den Discount-Whiskey deponiert. Ich nahm einen Schluck direkt aus der Flasche und behielt sie in der Hand. Doch während sich die Dialoge zwischen den drei Darstellern langsam entwickelten, merkte ich, dass sich jemand von hinten näherte, der mir die Flasche aus der Hand nehmen wollte. Ich drehte mich um und schaute direkt in Sabines Gesicht, die mich anlachte und flüsterte, sie wolle auch was trinken. Sie nahm einen Schluck aus der Flasche und gab sie mir zurück. Sabine kam mir gerade recht. Ihre Schulter berührte meinen Rücken. Das lag nicht nur daran, dass der Platz hinter dem Projektor so eng war. Das machte sie ganz bewusst. Es fragte sich, wie ernst ich es nehmen sollte. Der andere Schauspieler, Achim, erzählte gerade, wie ihm eine Geliebte erst die Uhr, dann Schallplatten und schließlich seine Lieblings-Wollsocken geklaut habe. Und dass er deshalb nicht mehr an das Gute im Menschen, und erst recht nicht an das Gute in den Frauen glaube. Die Zuschauer lachten, von Sabine hörte ich nichts. Ich verzichtete darauf, mich umzudrehen, bestimmt fand sie das auch lustig. Jetzt berührte sie mich nicht mehr. Ich schaute mich immer noch nicht um, denn es näherte sich bereits die Schlussszene, bei der sich die Schauspieler um den Hals fallen. Ich befürchtete, es könnte zu pathetisch wirken, oder vielleicht schwul. Martin zieht sein Hemd aus, aber damals, als wir es filmten, klebte es wegen dem Schweiß und er bekam es nicht schnell genug von den Schultern. Beim Drehen störte mich das nicht, da hatten wir schon ein paar Stunden auf dem Spielplatz verbracht, einige Flaschen Wein getrunken und mir ging es nur noch darum, dass die Schlusspointe klappte. Aber als ich die Einstellungen zusammenschnitt, merkte ich, dass das Ausziehen des Hemdes zu lange dauerte, da gab es plötzlich eine Lücke im Dialog und als ich versuchte, zu kürzen, sah wiederum der Bewegungsablauf ungelenk aus. Darum kehrte ich zur ursprünglichen Version zurück, was aber bei Super-8 einen wahrnehmbaren Schnitt hinterließ. Da schnippelt man ja mit der Schere direkt am Original herum, von dem es keine Kopie gibt. Rückblickend muss man sagen, das war schon beachtlich, wenn da überhaupt was rauskam, aber leider sah die Endfassung wirklich schwul aus. Also die Umarmung von Rainer und Martin, ganz abgesehen davon, dass der Schnittrhythmus durch das zu langsame Ausziehen des Hemdes verhunzt war. Achim, der dritte Schauspieler, machte es wieder wett, der umarmte die beiden anderen mit lockerem Schwung und dann kam ja auch schon ein paar Sekunden später die Pointe, bei der Martin in das Loch fällt, der hat die Hände noch auf den Schultern der Freunde, alle drei gucken in den Himmel und er rutscht zwischen ihnen nach unten weg und versinkt in einer Grube, die zu dem Kinderspielplatz gehört. Achim und Rainer sagen jeweils noch einen coolen Spruch und verschwinden in gegenüberliegende Himmelsrichtungen. Martin sitzt doof im Loch und der Film ist zu Ende. Den Satz von Rainer konnte aber kaum einer im Publikum verstehen, weil alle noch über Martins betroffenen Blick aus dem Loch lachten. Als die Abspanntafel erschien, nahm ich einen Schluck aus der Whiskeyflasche. Die Leute applaudieren und ich drehte mich um, wollte Sabine die Flasche reichen und mich von ihr anlachen lassen, aber sie war wieder verschwunden. Wie hatte die sich so unbemerkt davonschleichen können? Mir blieb keine Zeit, darüber nachzudenken, Martin zwängte sich durch die Menge zu mir, er lachte und war bestens amüsiert über die Gags im Film. Gläser für den Whiskey hatte er in der Hand, Rainer und Achim kamen von der anderen Seite. Da lagen wir uns plötzlich in den Armen, fühlten uns toll und darauf wollten wir uns ordentlich betrinken, auch wenn das keiner richtig zugab. Beim Trinken aus der Flasche hatte ich nur genippt, um meine Nervosität zu besänftigen. Aus dem Glas traute ich mir mehr zu und spürte, wie es in der Kehle warm wurde und das Hirn schien sich auszuweiten. Martin lachte immer noch, Achim, der Klugscheißer und Besserwisser begann, alle Anschlussfehler aufzuzählen. Das machte er immer, er war einer von denen, die sowas sahen: wenn die Zigarette nach dem Schnitt länger ist als vorher, oder wenn die Füllhöhe der Flasche nicht stimmt. Mir war sowas egal, während unserer Dreharbeiten veränderte sich sogar das Etikett auf der Weinflasche. Außer Achim kümmerte das sowieso niemanden, aber jetzt hatte ich meine Freude an seinen Ausführungen. Weil er so begeistert vom Film war und es lustig fand, was alles nicht stimmte, fand ich wiederum ihn lustig. Wir waren ja stolz darauf, dass wir einen Film gemacht hatten, der unperfekt und schäbig war. Wir wollten mit den normalen Unterhaltungsfilmen nichts zu tun haben. Martin griff Achims Thema auf und schlug vor, dass beim nächsten Film überhaupt nichts stimmen sollte, mit Absicht. Wir lachten und phantasierten um die Wette, was alles falsch sein könnte. Der falscheste Film aller Zeiten, das wäre doch was. Das beschäftigte uns noch den ganzen Abend und letztendlich landete ich auch mit der falschen Frau im falschen Bett. Sabine blieb verschwunden, aber es kamen neue Gäste, der Film lief noch zwei Mal, die Whiskeyflasche war drei Mal leer, die Lücken, die in der Erinnerung klafften, wurden länger, es lohnt sich nicht zu erzählen, was zwischen den Lücken passierte, mit wem ich alles betrunkene Gespräche führte. Doch je später der Abend wurde, desto häufiger blickte ich in das altbekannte Gesicht von Tina und letztendlich schliefen wir auf einer der herumliegenden Matratzen in der hinteren Kammer von Martins Wohnung. Wenn wir Sex hatten, dann bestimmt nicht viel. Vermutlich gar keinen. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie wir uns hinlegten. Als ich aufwachte, trug ich nur ein T-Shirt. Die Hose und die Unterhose lagen neben der Matratze am Boden. Ich musste dringend pissen. Auf dem Weg ins Klo sah ich, dass noch mehr Leute in der Wohnung schliefen. Der Boden war übersät mit leeren Flaschen und vollen Aschenbechern.
Im Lauf des Vormittags wachte einer nach dem anderen auf, es wurde viel Kaffee getrunken und blödes Zeug geredet, alle waren verkatert. Als Tina unter der Decke hervorkroch, fiel mir auf, dass sie ihre Strumpfhose noch anhatte. Sie küsste mich und ging ziemlich schnell nach Hause. Ich kümmerte mich schließlich ums Aufräumen und Putzen, abends kochten Martin, ich und ein Unbekannter mit Namen Florian gemeinsam Spaghetti. Dann ging ich zurück in meine WG und schlief lange.
3
Als ich erwachte, war Sonntag und meine WG leer. Erst abends kam Holger zurück, mein Mitbewohner, der Biologie und Chemie fürs Lehramt studierte. Mit ihm verstand ich mich am besten von allen meinen Mitbewohnern. Mein Problem, das ich ihm darlegen wollte, umschrieb ich mit der plakativen und grob vereinfachten Frage: Tina oder Sabine? Oder beide. Oder erst mal schauen. Oder keine von beiden, sondern lieber Vanessa. Holger kannte Tina ganz gut, Sabine überhaupt nicht und Vanessa kam ja gar nicht in Frage, denn Vanessa war die hübscheste Studentin der ganzen Stadt, niemand wusste, mit wem sie ihre Nächte verbrachte und ihr Name war bei uns ein geflügeltes Wort. Wer sagte, dann versuche ich es eben bei Vanessa, der meinte, dass ihm alles egal sei, weil es sowieso nicht klappt. Wenn es ums Klappen ging, war Tina die Favoritin, meinte Holger, denn Holger war schon immer der Meinung, dass Tina es auf mich abgesehen hatte. Ich will Tina aber gar nicht, antwortete ich. Willst du denn Sabine? Das weiß ich nicht. Nicht wissen heißt nicht wollen und wenn du nicht willst, dann bleibt nur Vanessa. Holger hatte wohl keine Lust, mein verzagtes Gerede anzuhören. Na ja, er hatte es leicht, er war schon seit fünf Jahren mit derselben Freundin zusammen und bestimmt würden sie irgendwann heiraten. Ich fand das damals so richtig spießig, aber wenn man keine Freundin, sondern immer nur kleine Abenteuer hat, stellt sich gar nicht die Frage. Mir erschien es damals, als ginge das auf keinen Fall, so eine feste Freundin, mit der man womöglich sogar zusammenwohnt, ebenso wie es mir absurd erschien, als Ingenieur zu arbeiten, obwohl ich das studierte. Das mit den Super-8-Filmen, war aber auch eine Scheinwelt und überhaupt nicht realitätstauglich. Dachte ich. Darum behauptete ich stets, dass ich einen bürgerlichen Beruf brauchen würde, während meine Existenz wie ein nervöser Brummkreisel unablässig und lärmend um künstlerische Projekte herumrotierte. Wenn man ihn nicht immer wieder durch die Spindel mit neuem Schwung auflädt, hört der Brummkreisel schnell auf zu brummen und fällt um. Aber ich rotierte weiter, wurde nicht müde, frischen Schwung in meine Projekte hineinzupumpen. Martin wollte beim nächsten Film Kamera machen, ich solle mich auf die Regie konzentrieren. Schön, aber erst einmal musste ein Drehbuch her. Die Idee, einen Film zu drehen, bei dem alles falsch sei, entpuppte sich als viel schwieriger, als zunächst gedacht. In meiner Ratlosigkeit vermutete ich sogar, es sei unmöglich. Achim erklärte großspurig, dass es vielleicht für alle anderen Filmemacher und speziell für die aus Hollywood unmöglich sei, aber nicht für MICH. Martin und andere, die bei ihm herumsaßen, sagten, mach doch einfach dies, oder das, wie wäre es hiermit, oder damit? Die waren immer sehr begeistert von ihren Ideen, mir aber gefiel keine. Erst als Sabine Vorschläge machte, hatte ich das Gefühl, es würde mir weiterhelfen. Erstaunt war ich auch darüber, dass sie eines Abends, vielleicht drei Wochen nach der Party, bei Martin saß. Ich hatte mich inzwischen zwar darum gekümmert, ihre Telefonnummer von meiner Mitbewohnerin zu erfragen, aber der Zettel mit der Nummer war nicht zu finden, als ich ein paar Tage später anrufen wollte. Noch später, als ich gerade in der falschen Stimmung war, tauchte erst der Zettel auf und dann sie, wieder auf der Matratze sitzend, im schönen Gegenlicht der kleinen Fenster von Martins Wohnung. Sie hätte damals zu einer unvermeidbaren Einladung gehen müssen, sagte sie in einem Tonfall, der den Vorwurf beinhaltete, dass ich das hätte wissen müssen. Als der Film zu Ende gewesen sei, hätte sie schon auf der Schwelle gestanden und sei sofort losgefahren, um die Pünktlichkeitstoleranz ihrer Gastgeber nicht übermäßig zu strapazieren. Der Film hätte ihr gefallen, allerdings sei sie unsicher gewesen, ob Rainer im Film schwul sein solle oder nicht und wie man das hätte interpretieren müssen, wobei er schwul aussah, aber dem Sinn des Filmes nach eigentlich nicht sein dürfte. Ja, ja, sie hatte genau die kritische Stelle erkannt, die mir auch nicht gefiel und lächelte dazu so wissend. Das beeindruckte mich, aber es verunsicherte mich auch und ich konnte es nicht lassen, sie in die Schwierigkeiten meines neuen Drehbuchentwurfes einzuweihen. Damit gab ich mir schon wieder eine Blöße und hoffte, sie würde das sympathisch finden.
Wir dürfen in dem Film nur Formalismen falsch machen, sagte ich, denn dramaturgische Fehler verzeiht der Zuschauer nicht. Also in dem Sinn, dass am Anfang nur Kleinigkeiten falsch sind, die im Lauf des Films immer auffälliger werden und am Schluss passiert was ganz Irrwitziges, also zum Beispiel kommt der Regisseur ins Bild oder die Kamera fällt um, oder, oder, oder, alles banale Ideen. Wie soll die Handlung sein? Hat die Handlung eine innere Logik oder ist sie willkürlich, damit sie sich von jeder konventionellen Struktur unterscheidet? Aber das gab es ja auch schon längst. Hatten Buñuel und Dalí mit dem „Andalusischen Hund“ in den zwanziger Jahren bereits gemacht. In der Fachliteratur werden Seiten vollgeschrieben mit der Vielschichtigkeit und Bildersprachlichkeit dieses Werkes und Buñuel sagt in seiner Autobiografie, sie hätten einfach gefilmt, was ihnen spontan einfiel. Wenn ich einfach das machte, was mir einfiel, war das mittelmäßiger Trash für die Subkultur, und wenn ich mir das Hirn zermarterte, damit es einen Hauch von Genialität abbekam, dann wurde es nur noch schlimmer. Das war dann wohl auch der Unterschied zwischen Buñuel auf der einen Seite und mir auf der anderen. Wenn die einfach mal drauflosfilmten, revolutionierten sie die Kinokultur, wenn ich das machte, war es nur banale Grütze. Wozu also anstrengen? Mit den Frauen war es ja so ähnlich: Manchmal bissen sie von alleine an, aber wenn ich mir erst in den Kopf gesetzt hatte, sie zu erobern, dann verscheuchte ich sie nur.
Nach dieser Behauptung machte ich eine Pause in meiner langen Rede und schaute Sabine an, ob sie was darauf antwortete. Sie sah heute wieder sehr gut aus. Und trank Rotwein, während ich noch am Kaffee nippte. Aber sie ging nicht auf meine Problematik mit den Frauen ein, sie kehrte zum Ausgangspunkt meiner Überlegung zurück: Es sei ein falscher Ansatz, alles falsch machen zu wollen, denn dann gebe es ja gar keinen Bezug mehr, an dem man falsch und richtig festmachen könne. Also wird nur das falsch gemacht, was beim Falschmachen Spaß macht. Was beim Falschmachen langweilt, wird richtig gemacht, denn Langeweile sei schlecht für Filme. Du bist ja eine Hedonistin, entgegnete ich, und sie sagte: Na klar! Ich bin für die falsche Moral, der Kommissar ist der Mörder und am Ende seiner Ermittlungen nimmt er sich selber fest, ist das falsch genug? Aber ich wollte keinen Krimi drehen, das sei das falsche Metier. Eben, sagte sie, das falsche, und falsch solle es ja sein und damit sei es richtig. Oder müsse es wieder so pseudointellektuell sein? Wie meinte sie das denn? War das Ironie? Außerdem sei der ganze Ansatz, alles falsch zu machen, ein intellektueller. Am intellektuellen Habitus führe hier sowieso kein Weg dran vorbei. Sie schaute mich versöhnlich an, aber ob sie mich wirklich ernst nahm, konnte ich nicht zweifelsfrei feststellen. Du hast selbst gesagt, dass du ein Pseudointellektueller bist, sagte sie lachend, ja, aber das habe ich ironisch gemeint, antwortete ich. Ich auch. Sie war wirklich undurchschaubar, hoffentlich würde ich mich nicht in ihren Launen verstricken. Da mischte sich plötzlich Martin ein und meinte, Sabine solle vorsichtig sein, mit dem, was sie sage, schließlich seien wir die Experten. Wie beabsichtigt, lachte sie ausgiebig über das Wort „Experten“ und legte mir schließlich den Arm über die Schulter. Schenkte mir dann auch ein Glas Rotwein ein und stieß mit mir an. Was soll aus euch eigentlich mal werden, fragte sie unvermittelt ernst. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, sondern schaute sie nur überrascht an. Bevor mir etwas einfiel, begann sie: Das ist ja ziemlich witzig, was ihr für Filme macht, aber gibt es einen Weg, der vom Hier und Jetzt dorthin führt, wo ihr hinwollt? Wo wollt ihr denn hin? Es kann natürlich auch sein, dass ihr einfach dableiben wollt, das würde ich euch zutrauen. Martin mischte sich ein: Willst du uns den Spaß verderben? Nein, ich will bloß herausfinden, ob ihr euren Aktivismus hinterfragt, und, wenn ja, wie. Mein Ex-Freund war ein Träumer, ich nicht. Das ging nicht lange gut. Weil ich nämlich gar keine Toleranz für realitätsfremde Menschen habe. Und außerdem bin ich gerade in einem Seminar über die Kaskadierung von Verkehrswegenetzen. Das ist ziemlich interessant. Da lernt man, dass bei falschen Rahmenbedingungen ganz schnell Sackgassen entstehen, oder dass eine Optimierung des gesamten Verkehrsflusses mit einzelnen, individuellen Umwegen von beträchtlichem Umfang verbunden sein kann. Mir ist aufgefallen, dass sich die Regeln für Verkehrswege auf Lebenswege übertragen lassen. Ich will nur vermeiden, dass ihr in eine Sackgasse hineinmanövriert oder euch Umwege aufhalst, die euch ins Hintertreffen bringen. An dieser Stelle des Gesprächs zeigte ich zu viel Interesse an der Kaskadierung von Verkehrswegenetzen. Darüber wollte ich wirklich etwas erfahren und das hatte dann zur Folge, dass wir eine Stunde oder länger über ihre geografische Verkehrsplanung diskutierten und nicht wieder auf die Lebensplanung von Provinzfilmemachern zurückkehrten. Angetrunken verließen wir Martin schließlich gemeinsam, aber gleich vor der Haustür musste sie in eine andere Richtung als ich. Sie schwang sich auf ein Holland-Fahrrad, dessen banales Speichenschloss sie ganz schnell geöffnet hatte und fuhr davon. Ich schaute ihr wehmütig hinterher.
Während ich nach Hause lief, wurde ich erst recht trübsinnig. Ja, ich war verliebt, aber mir schien, als sei diese Frau undurchschaubar und überheblich, wieso erklärte uns die Geografin die Welt, wir waren doch die Klugscheißer, die Künstler, die sich mit dem Wesen des Daseins und allen existentiellen Fragen beschäftigten. Während ich durch die leeren nächtlichen Straßen spazierte, erinnerte ich mich an die merkwürdigen Wendungen, die das Gespräch im Laufe des Abends genommen hatte, an die Vorschläge Sabines für mein Drehbuch und daran, dass ich es vermieden hatte, über den Nutzen unserer kreativen Aktivitäten zu reden und stattdessen überflüssiges Halbwissen über Verkehrsnetze erfahren und schon wieder weitgehend vergessen hatte. Jetzt interessierte es mich, was Sabine zu meinen Lebens-Lösungs-Ansätzen hätte sagen können, aber ich hatte vom Thema abgelenkt und deshalb war ich selbst schuld. Das waren die richtigen selbstkritischen Gedanken, um allein an der völlig unbelebten Straße längs der Bahnschienen herumzulaufen. Plötzlich stand ich vor der Werbefläche, die ich ein paar Wochen vorher unbedingt hatte bemalen wollen. Jetzt klebte dort eine Werbung für den Baumarkt: Eine gutaussehende Frau im Overall mit einem Farbeimer. Sie sah Sabine ähnlich, die gleiche Blondinen-Normalo-Frisur, aber zierlicher. Na klar, war ja auch ein Model, ein wirklich hübsches Gesicht, mit einem super Lächeln und super weißen Zähnen in ein Handwerker-Outfit hineingesteckt und gut in Szene gesetzt. „Mal dir deine Welt selbst!“, stand als Slogan neben dem Pinsel, den die hübsche Blondine nach vorne zur Kamera streckte. „Bist du dann auch mit drin, in meiner selbstgemalten Welt?“ fragte ich mich. „Und wenn nicht du, dann vielleicht Sabine?“ Aber da fielen mir Sabines merkwürdiges Verhalten und ihr kantiges Kinn ein und ich dachte mir, das Fotomodell von der Baumarktwerbung würde ich sofort mitnehmen, ohne Bedenken, ohne Rückfragen und Ideologiekontrolle, Sabine lieber nicht, denn wenn sie erst mal drin ist, in meiner selbstgemalten Welt, kriege ich sie vielleicht nicht wieder los und sie quält mich mit den kritischen Fragen, den halbwichtigen Fakten und den Proportionen ihres Körpers. Eigentlich gefiel sie mir nicht, aber ich war verliebt und deshalb empfand ich sie als attraktiv. Sagte ich mir, während ich die Baumarkt-Tussi mit ihrem perfekten Lächeln, ihrer perfekten Figur und ihrem perfekten Make-Up bestaunte und in einen kindischen Die-will-ich-haben-und-sonst-keine-Trotz verfiel. Die Farbe würde ich dann auch kaufen, wenn es sein muss. Ich langte in die Innentasche meiner Jacke und fühlte den dicken Faserstift. Den hatte ich Wochen zuvor in die Tasche hineingesteckt, jetzt zog ich ihn raus und schrieb ohne lange nachzudenken unter das „Mal dir deine Welt selbst!“ ein „Ok, mach ich!“ Dann steckte ich den Stift wieder ein und ging. Die paar Minuten, die ich brauchte, um nach Hause zu kommen, vergingen mit den Gedanken darüber, wie originell es sei, mitten in der Nacht den Entschluss zu fassen, das Zimmer neu zu streichen. Aber wann wäre es denn normal, solch einen Entschluss zu fassen?
4
Es ist total uncool, Pläne zu schmieden, und evolutionär, Bedingungen zu gestalten. Mit diesem tiefsinnigen Satz konfrontierte ich meinen Mitbewohner Holger zwei Tage später, als er mich mit dem Farbeimer in der Küche sitzen sah. Wie bitte? fragte er zurück und griff zum Wasserkocher. Er würde sich also einen Kaffee oder Tee machen, das gab mir genug Zeit, um meine Theorie zu erläutern. Sabines Vorwurf, dass wir keinen Plan hätten, steckte mir immer noch quer im Gemüt. Dass wir nicht wussten, wohin wir wollten und wie wir dahinkommen würden. Aber meine Theorie besagte, dass man keinen Plan braucht. Pläne führen zu Frustrationen, wenn sie sich nicht einhalten lassen, Pläne setzen eine Analyse der Verhältnisse voraus, die nichts nutzt, wenn sich die Verhältnisse ändern. Pläne haben den Nachteil, dass man an ihnen scheitern kann und das, vor allem das, will man doch nicht. Darum ist es cool, keinen Plan zu haben, dann kann man nicht scheitern, Nichtscheiternkönnen gibt Gelassenheit, Gelassenheit führt in Kombination mit einer kreativen Grundhaltung zu künstlerischem Output, der Output stärkt die Erfahrung und das Selbstbewusstsein und dann fügt sich bei geeigneten Randbedingungen Eins ins Andere. Die Bedingungen sind beispielsweise Fähigkeiten und Kontakte, Ersparnisse und Arbeitsräume, Ferien ohne Ferienjob, vielleicht sogar Sex ohne Beziehung. Anregung, Inspiration, Grenzwerterfahrung. Oder ein frisch gestrichenes Zimmer. Bisher hatte ich immer gedacht, ich brauchte nur das einfachste aller Zimmer, kein Schnickschnack, kein Zierrat, kein Nippes, aber dann glaubte ich zu bemerken, dass dieses schmutzige Gelbbraun der Wände mich geistig bremste. Das wirft mich immer wieder zurück auf mich selbst. Das willst du doch, warf mein Mitbewohner ein, der gerade die Milch in seinen Kaffee goss und langsam umrührte. Das cremige Braun erinnerte mich an meine schmutzige Raufasertapete. Nein, ich will das nicht … mehr! antwortete ich, darum habe ich die Farbe gekauft. Er schaute mich irritiert an. Wie aufgezogen schweifte ich zu einem meiner Lieblingsthemen ab, auch wenn es nicht so richtig als Argumentation passte. Weißt du, es gibt Typen, die tragen in ihrer Tasche jahrelang das Drehbuch ihres Bewerbungsfilms für die Filmhochschule mit sich herum und dabei reden die auch noch jahrelang darüber und letztendlich werden sie abgelehnt, oder sie bekommen den Film gar nicht fertig, ach, noch schlimmer, manche fangen gar nicht damit an, solche Typen sind doch total uncool! Holger stimmte mir nur eingeschränkt zu. Im Fall einer Ablehnung: Ja! Aber wenn sie genommen würden, dann wäre alles, was sie vorhergemacht haben rückwirkend richtig. Das ist doch alles so verkrampft, entgegnete ich auf seinen Einwand. Wenn es nur ums Coolsein ginge, würde niemand mehr Lehramt studieren, so wie ich. Mein Mitbewohner drehte sich eine Zigarette und ich schnorrte ihn um Tabak an, da ich keinen mehr hatte. Um die Bedingungen für die Entwicklung meiner künstlerischen Aktivitäten zu optimieren, hatte ich darauf verzichtet, mir Zigaretten oder Tabak zu kaufen. Aber jetzt, beim Kaffee in der WG-Küche erschien es mir, als verhindere der Mangel an Nikotin jede Art des Wohlfühlens. Außerdem waren die Wände noch nicht gestrichen. Nach dem Streichen könnte ich noch mal darüber nachdenken, mit dem Rauchen aufzuhören. Die besten technischen Errungenschaften, fuhr ich fort, verblassen gegen die Genialität der Natur und der biologischen Systeme. Aber die haben keinen Plan gehabt, sondern sind Schrittchen für Schrittchen verbessert worden, durch evolutionäre Selektion. Keine Pflanze und kein Tier hat durch Analyse herausgefunden, wie es sich besser an die Welt anpassen könnte und trotzdem entstanden dadurch bewundernswerte funktionierende Wesen. Vielleicht hätte ich nicht in den Bereich der Biologie abschweifen sollen, denn da kannte sich Holger aus. Er hatte ein paar Argumente gegen mich, die mir nicht in die Lebensplanung passten. Einerseits, sagte er, solle ich bedenken, dass die Evolution nicht nur aus den Überlebenden bestehe, sondern zum beträchtlichen Teil aus den Ausgestorbenen. An die denke man nicht so oft, weil man sie nicht sehe, aber das seien enorm viel. Woher nähme ich also meine Hoffnung, dass ich mich zu den Gewinnern der Selektionsprozesse zählen könne? Und andererseits habe die biologische Evolution wahnsinnig viel Zeit und die habe ich nicht. Also: Einerseits werde das planlose Ich-schau-mal-was-ich-hier-und-heute-machen-kann nicht zwangsläufig in der Genialität, sondern vielleicht genauso gut in der Mittelmäßig- oder gar Bedeutungslosigkeit enden, andererseits könne es auch sein, dass diese kleinen Schrittchen des evolutionären Prozesses zwar zwangsläufig zu den höchsten Höhen des künstlerischen Wirkens führten, aber leider so langsam, dass alle wie auch immer gearteten Teilziele erst nach 100 Jahren erreicht würden und da würde dann die biologische Begrenzung des Lebens den Prozess einfach abschneiden, was aber eventuell egal sei, da ja auch die soziale Begrenzung des Lebens dazu führen könne, dass ab einem bestimmten Alter der Weg gar nicht weiter beschritten werden könne, also genaugenommen vielleicht schon in einem Jahr und sieben Monaten, denn das war der Zeitpunkt, an dem mein Bafög auslaufen werde. Und dann? Mein Mitbewohner wollte gar keine Antwort mehr hören, er nahm seine halbvolle Kaffeetasse und erklärte mir, dass er jetzt für die Prüfung lernen müsse, damit er das Studium in der Regelstudienzeit abschließen könne, das sei nämlich sein PLAN. Dann verschwand er amüsiert und ließ mich etwas ratlos zurück. Vermutlich war die Eheschließung und die Zeugung von Kindern unmittelbar nach dem Examen vorgesehen und in seinem lückenlosen Plan enthalten. Die nächsten existentiellen Fragen würden sich für Holger erst stellen, wenn es um die Gestaltung des Rentendaseins ginge.
5
Ein paar Tage später kam Sabine in unserer WG vorbei, aber nicht wegen mir, sondern wegen meiner Mitbewohnerin. Es herrschte ein heilloses Durcheinander, da ich einen Teil meiner Möbel in den engen Flur gestellt hatte, um mein Zimmer zu streichen. Das Gepinsel machte überhaupt keinen Spaß. Erst recht nicht das Geputze und Gewische, wenn der Pinsel getropft hatte. Obwohl ich ja nur ein kleines Zimmer bewohnte, kam mir der Aufwand immens vor. Inzwischen zweifelte ich daran, dass mir die strahlend weißen Wände jene positive Energie vermitteln würden, die ich mir von ihnen erhofft hatte. Aber erst einmal musste ich viel Energie reinstecken, Zimmer ausräumen, Malen, Zurückräumen und so weiter. Die Farbe deckte nicht gut, nach dem zweiten Anstrich war das Weiß keineswegs makellos. Aber ich beschloss, dass ich keine makellosen Wände brauchte. Als Sabine ihren Kopf durch die Tür steckte und sich nach meinem Wohlbefinden erkundigte, fehlte mir nur noch die Wand mit dem Fenster und das wollte ich an dem Tag erledigen. Ich machte ein paar Witze über die Mühsal des Heimwerkens, die Sabine nicht zum Lachen brachten. Sie wirkte unbeeindruckt und dann standen wir uns ratlos gegenüber, weil sie nicht reinkommen wollte in meine schmutzige Baustelle und ich nicht raus. In zwei Stunden bin ich fertig, nur noch die letzte Wand, sagte ich und fügte die Frage an, ob sie dann noch da sei. Das wisse sie nicht, komme auf meine Mitbewohnerin an. Was habt ihr denn vor? Seminararbeit besprechen und dann Wein trinken, voraussichtlich irgendwo draußen. Also nicht in meiner frisch gestrichenen Welt. Ich muss jetzt dringend loslegen, sagte ich und tauchte die Rolle in die Farbe. Sagt mir doch einfach, wenn ihr rausgeht, und wohin, schlug ich vor. Dann rollte ich los, mit der Farbrolle. Sabine zog sich von der Türschwelle zurück und schloss die Tür. Sollten die beiden erstmal ihre Seminararbeit besprechen, in der Zwischenzeit kam ich mit dem Streichen gut voran und freute mich darauf, fertig zu werden. Während ich am Erker herumfummelte und mich bemühte, das Holz vom Fensterrahmen sauber zu halten, hörte ich die Klingel, später dann auch Stimmen im Flur. Beim weiterpinseln konnte ich bemerken, dass sich offensichtlich Menschen in der Küche unterhielten. Die Stimmen kamen mir bekannt vor, aber ich erkannte sie nicht. Ich würde es mir später ansehen, wer da in der Küche herumsaß, erst einmal musste gemalert werden. Neugierig war ich schon und dann hörte ich das Lachen, das mir so bekannt vorkam. War das Sabine? Ihr lautes Lachen, als ich die Salzstangen in Martins Wohnung verteilte, fiel mir ein. Nein, ich hatte mich wohl getäuscht, oder doch nicht? Ging es in der Küche um das Seminar, oder waren sie schon betrunken? Sollte ich mir auch ein Glas holen? Die letzten zwei Quadratmeter lagen vor mir, jetzt keine Ablenkung, rein mit der Rolle in den Farbeimer. Ich hätte früher anfangen sollen, doch nachdem ich aus der Vorlesung gekommen war, hatte ich erst mal ausgiebig Kaffee getrunken, war dann Einkaufen gegangen, hatte anschließend zu Abend gegessen. Beim Anziehen meine Arbeitsklamotten war es schon halb sieben, da brauchte ich mich nicht wundern, dass ich um neun noch pinselte, während in der Küche gelacht wurde und jetzt wieder Sabine, diesmal war ich mir sicher, dass sie es war, die lachte. Merkwürdig erschien mir, dass sie überhaupt nicht lachte, wenn sie sich mit mir unterhielt. Bei unseren Gesprächen hatte sie stets diesen besorgten Ton, etwas Mütterliches, als würde sie sich Sorgen um mich machen und das machte ich mir ja auch. Doch im Gespräch mit anderen, wenn ich mich entfernt hatte, entwickelte sie sich offenbar zur Stimmungskanone. Und jetzt schon wieder. Andererseits war es mir ganz recht, wenn mir eine besondere Behandlung zuteil wurde. Darauf begründete sich meine Hoffnung, dass sie sich in mich verlieben könnte oder schon hatte. Nein, sie hatte sich bestimmt noch nicht verliebt, aber sie sah bei mir das entsprechende Potential. Jetzt kam es darauf an, dranzubleiben, ohne ihr auf dabei die Nerven zu gehen. Sagte ich mir. Vielleicht sogar durch künstliche Verknappung. Mach dich rar! Aber das tat ich schon die ganze Zeit. Jetzt auch! Ich pinselte weiter. Auf jeden Fall erst die Wand fertig machen und die Abdeckplanen zusammenlegen. Weitermachen und den Geräuschen lauschen, die durch die geschlossene Tür zu mir hereindrangen. Ab und zu ein paar Wortfetzen oder Gelächter, aber kein einzelnes Gelächter von Sabine, immer nur kollektives Gelächter. Wer waren die anderen? Vermutlich meine Geografie-Mitbewohnerin. Die lachte in meiner Anwesenheit auch nie, schon gar nicht, wenn ich versuchte, einen Witz zu machen. Ich glaube, die hielt meine Ironie stets für puren Ernst. Und wenn ich etwas ernst meinte, hörte sie nicht zu. Oder behauptete, das sei unverständlich, oder ich hätte ein selbst ausgedachtes Wort gebraucht, oder es sei aus dem Philosophielexikon geklaut. Beim Pinseln und Lauschen steigerte ich mich in eine Aversion gegen meine Mitbewohnerin hinein, ich geriet geradezu in Rage angesichts ihres Verhaltens, das mir latent schon lange auf die Nerven ging. Ganz zu schweigen davon, dass ich Geografie für überflüssig hielt, meinen Atlas hatte ich schon. Nur die Theorie mit der Verkehrswege-Kaskadierung war beeindruckend gewesen. Vielleicht tauschten sich Sabine und meine Mitbewohnerin über genau diese Theorie aus? Wobei ich mir wie selbstverständlich einredete, dass nur Sabine dieses anspruchsvolle Seminar belegte, während meine Mitbewohnerin irgendwas banal Einfaches wählen würde. So und dann rollte ich die Malerrolle zum letzten Mal, die Wand war fertig gestrichen. Nicht sehr ordentlich, scheiß drauf, ich wollte jetzt endlich wissen, was die in der Küche redeten. Die Plastikplane zog ich schnell vom Bett und dann das große Tuch vom Schreibtisch. Heute Abend könnte ich sogar im eigenen Zimmer lernen, aber ich würde es bestimmt nicht tun. Keine Lust und keine Notwendigkeit. Ich streifte die bekleckste Arbeitsjacke ab und ging in die Küche, um endlich zu sehen, wer dort alles versammelt war.
In der Tat staunte ich, denn Martin saß am Tisch, gemeinsam mit meiner geografischen Mitbewohnerin, außerdem Holger und Sabine. Zu allem Überfluss lehnte auch noch der Tennispartner von Holger am Herd. Der Tennispartner war ein Schwätzer und Martin kam eigentlich nie zu mir, denn ich ging immer zu ihm, wenn wir uns treffen wollten. Jetzt saß er am Tisch und trank Rotwein. Man hat mir empfohlen, dich nicht bei der Malerei zu stören, sagte er. Ich wollte dir helfen, die Schränke wieder zurechtzurücken. Mit Malen bin ich fertig, antwortete ich, Möbelrücken will ich erst morgen. Martin und Möbelrücken, das machte mich stutzig. Auf dem Tisch standen zwei leere Weinflaschen, am Fußboden noch eine, Mist, alles leer, oder hatte jemand geheime Vorräte im Zimmer? Man bemerkte meinen suchenden Blick. Der Wein ist alle, erklärte Martin, und dann mischte sich der Tennispartner ein, ob wir nicht alle noch in die „Schänke“ gehen wollten. Die Schänke konnte ich nicht leiden, genauso wenig, wie ich den Tennispartner leiden konnte, außerdem war es weit, viel zu weit, um mitten in der Woche noch schnell mal vorbeizuschauen. Dummerweise mischten sich beide Geografinnen ein, sie wollten da auch hin. Martin sagte nichts, aber er scheute sowieso keine Mühe, wenn es darum ging, in eine Kneipe zu gehen und außerdem brauchte er bestimmt nicht früh aufstehen, während ich um neun im Praktikum zu erscheinen hatte. Der Tennispartner fing an, von verschiedenen Biersorten zu erzählen. Englische Biere und Irish Pubs waren seine bevorzugten Gesprächsthemen, mit denen er mich ganz schnell vertreiben konnte. Ob wir denn mit dem Fahrrad hinfahren würden, fragte ich, aber Martin und meine Mitbewohnerin wollten zu Fuß gehen. Holger meinte, wenn Martin gerade hier sei, um mir zu helfen, sollten wir wirklich ein paar Möbel aus dem Flur in mein Zimmer schieben, damit endlich wieder etwas Ordnung einkehre und er nicht nochmal gegen den Schrank laufen würde, wenn er nachts aufs Klo müsse. Wollt ihr wirklich in die „Schänke“? fragte ich entnervt. Sabine war unerwartet entschlossen: Ja, unbedingt! Dann bleibe ich hier, sagte ich und sie beteuerte, dass sie das bedauere, erhob sich aber gleichzeitig, begann, ihre Klamotten zusammenzusuchen. Während sie sich anzog, schoben Martin und Holger mit mir den Schrank ins Zimmer und dann meinte Martin, den Rest würde ich bestimmt alleine schaffen. Wieso hatte er es denn so eilig, wenn er gekommen war, um mir zu helfen? Schon verschwanden sie alle, Sabine winkte von der Tür aus, nur Holger blieb, der packte noch ein paar kleinere Möbel, um sie mir in mein Zimmer zu tragen. Zu guter Letzt nahm er den Clubsessel, stellte ihn neben mein Bett und ließ sich hineinfallen. Vergiss Sabine, meinte er, sie sei undurchsichtig und außerdem würde sie schon in zwei Wochen fortziehen. Woher er das wissen würde? Das hätte sie in der Küche ausführlich erzählt. Die geografischen Verhältnisse an unserer Provinz-Universität würden ihr nicht mehr ausreichen. Martin hätte ihr dauernd Recht gegeben, dabei habe der mit der Universität gar nichts zu tun, aber die Provinz-Beschimpfer und Metropolen-Hochjubler seien ja allgegenwärtig. Holger war durchaus bodenständig, mit ihm konnte ich über all die Leute lästern, denen keine Stadt zu groß war. Vermutlich würde Holger nach dem Studium nicht nur heiraten, sondern auch zurück aufs Land gehen, um dort Lehrer zu werden, wo er selbst in der Schule gewesen war. Dass Sabine mir gegenüber nie verraten hatte, dass ihre Zeit schon fast abgelaufen war, traf mich sehr, das war eine empfindliche Kränkung. Und Holger wusste mehr als ich. Hätte ich mich doch nicht um die vergilbten Wände kümmern sollen, sondern lieber um Sabine selbst. Zwei Wochen? Da war ja eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden musste, und wenn ich irgendwas für sie bedeuten würde, hätte sie es mir erst recht mitteilen müssen, dass sie verschwindet, das war ja alles Verarschung, sagte ich und Holger meinte, er habe soeben Sabine zum ersten Mal bewusst wahrgenommen hätte, sie sei sehr sonderbar gewesen, er wisse aber auch nicht warum, außerdem habe sein Tennispartner dauernd dazwischen gequatscht. Meinte er das ernst oder wollte er mich trösten? Ich schnorrte Holger mal wieder um Tabak an und drehte mir eine Zigarette. Nicht zu Rauchen angesichts dieser herben Enttäuschung erschien mir unangemessen. Ganz zu schweigen davon, dass der Wein alle war. Egal, ob die Zimmerwände jetzt strahlend weiß waren oder nicht, ich würde mir erstmal wieder einen Tabak kaufen. Holger spendierte mir dann noch einen Drink von einem 18 Jahre alten Whiskey, den er in seinem Zimmer versteckt hielt, das Geschenk des Opas zum Vorexamen oder sowas Ähnliches. Der Whiskey beruhigte mich. Ich fragte mich und Holger, ob ich vielleicht in einer Scheinwelt lebe, ob ich ein Opfer von Realitätsverlust sein könnte. So sicher war ich mir gewesen, dass da was dran sei, an diesem heißen Draht, den ich zu Sabine verspürte, aber jetzt sah es so aus, als wäre das nur Einbildung gewesen. Zwei Wochen, dann würde sie ihre Wohnung schon räumen, erst Exkursion, dann Praktikum und danach sollte es in Berlin weitergehen. Da lohnte es sich doch gar nicht, ihr noch hinterherzutelefonieren. Ich lasse sie abhauen und hoffentlich fragt sie nicht, ob ich beim Umzug helfen könne. Bloß das nicht.
6
Die Wände meines Zimmers waren nun also schön weiß, ich kaufte mir wieder regelmäßig Tabak und kümmerte mich erstmal nicht um den Vorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören. Aus Trotz ging ich ausgiebig trinken, meist mit meiner alten Bekannten Tina und dann, seit langen endlich mal wieder einmal auf ein Punkkonzert. Von Sabine hörte ich nichts und ich selbst vermied jede Kontaktaufnahme. Aber ich setzte mich an den Schreibtisch und dachte über das Drehbuch nach, das Drehbuch für den Film, bei dem alles falsch sein sollte. Ich würde selbst die Hauptrolle übernehmen, das war bestimmt falsch und es sollte auch eine Frau mitspielen, aber keine junge, sondern eine möglichst alte. Für die Kamera wollte ich nun nicht mehr Martin nehmen, er mit seinen fotografischen Ambitionen war zu gut. Ich brauchte jemanden, der sowas noch nie gemacht hatte, zum Beispiel Tina. Für sie, als Punk-Ideologin seit frühester Jugend sollte ein kreativer Ausflug in die Kunst der Bildgestaltung kein Problem sein. Sie wollte immer ein Musikinstrument lernen, hatte aber keine Geduld zum Üben, da bietet sich Filmemachen als Kompensation geradezu an. Schwieriger war es mit der alten Frau, wen sollte ich nehmen? Ich kannte keine alten Frauen. Zu professionellen Schauspielern hatte ich kaum Kontakte, das wollte ich auch gar nicht. Mir kam es so vor, als sei die Arbeit mit Laienschauspielern kreativer und authentischer als mit den mittelmäßigen Profis aus dem Provinztheater. Vielleicht war das aber auch nur wieder meine Verweigerungshaltung. Alles ablehnen, was reibungslos funktionieren könnte. Wenn alles funktioniert, dann steckt man fest in der künstlerischen Gestaltungsverantwortung. Wenn man Verantwortung tragen will, kann man ja auch Ingenieur werden, oder eine Firma leiten, womöglich beides. Da schienen mir die Unwägbarkeiten der Subkultur verlockender, ganz zu schweigen von dem Sympathievorschuss, der einem als Künstler im Allgemeinen entgegengebracht wurde. Aber etwas Inspiration und Arbeit musste man aufbringen und daran kämpfte ich gerade bis zur beginnenden Verzweiflung, weil ich mich immer noch nicht entscheiden konnte, was überhaupt passieren sollte. Vielleicht gar nichts? Stimmungsvolles Nichts füllte schon erfolgreich unzählige Künstlerfilme. Außerdem gab es auch noch die Idee mit dem Kommissar, der nicht ermittelt, sondern nur darüber jammert, dass der Fall unlösbar sei, und am Schluss verhaftet er sich selbst oder es wird das Verfahren eingestellt. Die Frau im fortgeschrittenen Alter könnte behaupten, ihr Mann sei ermordet worden, und dann taucht er plötzlich auf. Aber inzwischen hat sie sich soweit in Widersprüche verwickelt, dass niemand an ihre Unschuld glaubt. Außerdem wollte Martin unbedingt seine vielen Gummienten im Filme haben. Die exzessive Inszenierung der Gummienten erschien mir durchaus passend, solange sie keinerlei Beziehung zu der kriminalistischen Handlung eingehen würden. Zumal geplant war, den Film in Schwarzweiß zu drehen. Wenn gelbe Gummienten einen visuellen Schwerpunkt des Filmes setzen sollten, war das beliebte ORWO-Material aus der DDR unbedingt die falsche Wahl und so steckten schon einige eklatante Fehler in den Eckpunkten dieses Projektes.
Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits ein paar Rollen ORWO-Super-8-Material abgedreht, jetzt wollte ich den ersten Kurzfilm damit realisieren. Damals gab es Super-8-Filme in der Standardausführung von Kodak oder Agfa in jedem Fotoladen oder im Kaufhaus. Ich kaufte mir damals immer Dreierpacks, das waren gut 10 Minuten Film, die kosteten 40 Mark und die Entwicklung war im Preis inbegriffen. Wer 25 Jahre später mit der digitalen Videokamera herumfilmte, der konnte sich meist gar nicht vorstellen, dass man nur für die Aufnahme so viel Geld ausgeben musste. Diese Leute hatten aber auch die DDR verpasst, von der ich noch einiges mitbekam, obwohl ich im Westen aufwuchs. Die meisten Menschen interessierte es gar nicht, wie es da drüben aussah, außerdem bekamen sie das von den Medien ausführlich und kapitalismuskonform unter die Nase gerieben: Wie unerträglich der real existierende Sozialismus sei, so dass ihnen schon vor der Abfahrt der Spaß verdorben wurde. Alles traurig, hoffnungslos und grau, hieß es. Grau war es wirklich, aber traurig fand ich es keineswegs. Vielleicht lag das an meinen Verwandten, die schienen ganz normal zu sein. Die freuten sich, als ich als Student tatsächlich alleine zu ihnen kam. Vorher war es immer Familienbesuch gewesen, mit meinen Eltern, und Mutter musste die ganze Zeit meckern, weil sie immer meckerte, einerseits über den Fahrstil meines Vaters, andererseits über die Sozialisten, die uns alles wegnehmen wollten, sogar unsere schöne D-Mark, denn die Sozialisten kassierten sie in Form des Zwangsumtausches. Pro Person mussten täglich 25 wertvolle Westmark zum Kurs von Eins zu Eins in die nutzlose Ostmark getauscht werden, die wir nicht brauchten, da wir ja bei unseren Verwandten schliefen und von ihnen mit Bockwürsten und Bier durchgefüttert wurden. Dass man aber den Zwangsumtausch auch dazu benutzen konnte, Schwarzweiß-Super-8-Filme zu kaufen, das merkte ich erst, als ich alleine im Land war. Während ein Schwarzweißfilm im Westen gut das Doppelte eines Farbfilmes kostete, war das ORWO-Material nach offiziellem Umtauschkurs genauso teuer wie das Farbmaterial. Wenn man das Geld schwarz tauschte, waren diese Filme spottbillig. Oder sogar geschenkt, denn meine Verwandtschaft spendierte mir gleich einen Zehnerpack. So nett waren die. Das konnte ja nicht nur an dem bisschen Kaffee liegen, den ich als Gastgeschenk mitgebracht hatte. Aber der Kaffee war der greifbare kleinste Teil einer großen Vision, die wohl darin bestand, dass die Menschheit von quälenden materiellen Sorgen befreit werden könne und diese Vision wurde auf mich, den Überbringer, projiziert, während ich wiederum die Vision hatte, dass die Nettigkeit meiner Onkels und Tanten ebenfalls Teil einer größeren Idee sei, die die Menschheit von ihren Materialismus befreien möge, da der Materialismus sowieso nicht zur Zufriedenheit führt und viel zu viele schädliche Nebenwirkungen hat. Das schlussfolgerte ich, weil ich meistens unzufrieden war, obwohl ich doch in der sagenumwobenen Bundesrepublik der ausgehenden 80er-Jahre lebte. In dieser Zeit an diesem Ort hatte man keine existentiellen Sorgen, außer der kleinlichen Angst, es könne einen atomaren, alleszerstörenden Krieg geben oder einen Bundeskanzler, der Franz Josef Strauss hieße. Die Vor-Wende-Bundesrepublik empfand ich intuitiv als gute alte Zeit. Es ging mir so gut, dass ich nur Selbstverwirklichungsprobleme hatte und wenn man mich gefragt hätte, ob ich auch im Osten leben könnte, dann wäre es mir sehr schwergefallen, mit Ja zu antworten, denn erstens gab es dort all die Schallplatten, die schon bei uns in der Provinz nur mit Mühe zu kriegen waren, überhaupt nicht, zweitens hatten die im Osten schlechte Zähne. Später wurde zwar manchmal behauptet, das Gesundheitssystem im Sozialismus sei gut gewesen. An den Zähnen der Durchschnittsbevölkerung konnte man das nicht ablesen. Auf der Straße traf man kaum jemanden, der ein hübsches Lächeln mit ordentlichen Zähnen bieten konnte und das Gebiss meiner Tante sah wirklich zum Fürchten aus. Das gefiel mir überhaupt nicht. Drittens war es im Westen inzwischen selbstverständlich, dass man als junger Mensch alleine in einem Zimmer leben durfte. Kein eigenes Zimmer für mich zu haben, schien mir in der Tat als nicht hinnehmbarer materieller Mangel. Wo, oder vielmehr wann sollte man denn in Ruhe onanieren, wenn man die Studentenbude mit einem Kommilitonen teilen musste? Mehrbettzimmer waren in den sozialistischen Studentenwohnheimen die Regel, naja, das hätte ich umgehen können, indem ich erst nach dem Diplom übersiedelte, was aber nie zur Debatte stand. Stattdessen ergab es sich, dass ich gar nicht mehr rüber durfte, was aber auch nicht schlimm war, da sich das ideologisch umstrittene Gebilde DDR etwas später unterwartet von alleine auflöste.
7
Ich wollte mir einen Vorrat an ORWO-Filmen holen, mit schwarz getauschten Devisen. Das Drehbuch für den falschesten Film aller Zeiten war mit Martins Hilfe fertiggeworden, als Schauplatz war seine malerische Wohnung vorgesehen, die Frau im fortgeschrittenen Alter sollte seine große Schwester sein, die zwar nur 12 Jahre älter als er war, aber ziemlich spießig aussehen konnte. Schauspielerische Erfahrung fehlte ihr völlig. Das ist gut, sagten wir, sie wird sich überhaupt nicht bewegen müssen, alle ihre Dialogbeiträge werden vor einer Fototapete aufgenommen werden, während sie auf einem Stuhl sitzt. Der Gegenschuss wird aber ganz wo anderes gedreht, nämlich zwischen den langweiligen Nachkriegsaltbauten der Provinzstadt. Ich hatte beim letzten Rasieren darauf verzichtet, die Stoppeln unter der Nase abzuschneiden und hoffte darauf, ein Schnurrbart könnte mich für die Rolle des antriebslosen Kommissars geeignet aussehen lassen. Schnurbärte waren damals genauso out wie später.
Martin befand sich schon seit einer Woche in Berlin, er wollte dort wegen den Aufnahmebedingungen einer neuen Medienakademie Erkundigungen einholen und verriet mir nicht, wieso das eine ganze Woche dauern sollte. Ich wiederum war zu Hause in Süddeutschland zur ganz normalen Sparkasse gegangen und hatte dort offiziell Westgeld gegen Ostgeld getauscht, eins zu sechs. Das dürfen sie aber nicht in die DDR einführen, sagte mir der Bankangestellte und ich antwortete, dass ich das wüsste. Trotzdem war klar, was ich vorhatte, denn was sollte man mit DDR-Geld sonst machen? Um internationale Geschäftsbeziehungen über den Eisernen Vorhang hinweg zu beginnen, waren 350 Ostmark ja wohl auch etwas zu wenig. Das waren ein paar Scheine und die passten in den Fotoapparat. Dort, wo die Filmpatrone hingehörte, stopfte ich die zusammengefalteten Scheine hinein. Die eifrigen Grenzbeamten würden doch hoffentlich nicht meinen Fotoapparat öffnen, das hieße ja, dass sie den Film, der normalerweise drin sein sollte, belichten würden. Wobei ein Fachkundiger schon erkennen konnte, dass das Zählwerk auf Null stand und deshalb entweder gar kein Film vorhanden war, oder er war noch nicht eingefädelt und man würde durch das Öffnen des Deckels auch nichts zerstören. Trotzdem hielt ich dieses Versteck für supersicher, zumal ich in Berlin-Friedrichstraße als Tagestourist rüber gehen wollte, da gab es keine obligatorischen Durchsuchungen wie bei der Einreise mit dem Auto.
Also packte ich den Rucksack und ließ mich zur Autobahnraststätte bringen, damit ich dort lostrampen konnte. Damals machten das noch viele und speziell auf der Route nach Berlin standen oft viele Gruppen und Einzelpersonen mit ihren Pappschildern. Aber wenn man dann endlich jemand hatte, der einen mitnahm, kam man gleich bis ans Ziel, da so gut wie niemand die Transitstrecke verließ. Von Bayern aus war es die längste Strecke, die schier endlos über die holprigen Betonpisten der DDR-Autobahnen führte. 100 km/h als strikte Geschwindigkeitsgrenze, da konnte man lange Gespräche führen. Über die DDR, übers Trampen, über Geschwindigkeitskontrollen, über andere Tramper und andere Autofahrer, über Wartezeiten und Raststätten. Eigentlich immer das gleiche Blabla. Obwohl ich früher oft auf diese Weise unterwegs war, kann ich mich nur an wenige Fahrer erinnern, meist an die schrägen Typen, aber auch das nur vage. Die meisten, und das waren die weitgehend normalen, sind völlig aus der Erinnerung verschwunden. Später, als ich ab und zu selbst mit dem Auto fuhr und mich bei der Menschheit revanchieren wollte, gab es keine Tramper mehr, obwohl ich oft an den Raststätten rausfuhr, ohne eigentlich halten zu wollen. Nur mal schauen, ob jemand mitwill. Eine simple, aber funktionierende Methode, damit Leute zusammenfinden, deren Interessen sich ergänzen. Vermutlich zu einfach. Trampen war plötzlich nicht mehr angesagt, niemand wollte mehr anhalten. Mitfahrzentralen übernahmen den Markt, bis es ihnen an den Kragen ging, denn eines Tages drehte die Bahn durch und schmiss für extrem wenig Geld die erste Version des Wochenendtickets auf den Markt. Sieben Personen durften zwei Tage lang im ganzen Bundesgebiet die Nahverkehrszüge nutzen, für lachhafte 25 Mark. Bloß weil es sensationell billig war, fuhren sie alle hin und her, kreuz und quer durchs Land oder sonst wohin. Trampen war nicht billig, es war ganz umsonst, trotzdem verschwand es als Verkehrssystem. Aber es verschwanden ja ganze Länder, so wie die DDR, deren Durchquerung auf der Transitstrecke zwar endlos erschien, aber schließlich näherte man sich dann doch der geheimnisumwitterten Mauerstadt Berlin. Nochmal eine Grenzkontrolle an einer riesigen Station und dann kamen wir zur Raststätte Dreilinden, der Westen hatte mich wieder. Mein Fahrer nahm mich mit bis zum Kaiserdamm und empfahl mir die U-Bahn.
Martin hatte eine Übernachtungsmöglichkeit bei einem Freund im Wedding. Dort sollte auch ich schlafen. Damals fand ich die schmuddeligen Treppen der Hinterhäuser und Seitenflügel mit ihren kaputten Briefkästen noch ziemlich aufregend. Oder verwahrloste Mülltonnenabstellplätze. Billige Negation, opportunistische Antihaltung. Aber Florian, der sowieso nur Untermieter und erst vor drei Monaten nach Berlin gekommen war, sah das ganz unideologisch und pragmatisch. Er hatte mit Martin und mir am Tag nach der Filmpremiere Nudeln gekocht. Berlin-Neulinge landeten oft zunächst im Wedding. Auch Martin könnte, sofern er einerseits mit seiner Aufnahmeprüfung erfolgreich wäre und andererseits Florian wie geplant im Herbst in eine Kreuzberger Loft-WG rein käme, die Tradition fortsetzen, indem er Florians Wohnung übernähme. Das tat er dann, als es soweit war, nicht und zwar aus einem anderen Grund, der mir gar nicht passte, aber als wir abends wieder bei Nudeln mit Tomatensoße zusammensaßen, erzählte Martin begeistert von der privaten Akademie für Digitale Künste, die ja ganz neu gegründet worden war, weil sich alle anderen Akademien und Kunsthochschulen viel zu wenig um die Digitalität kümmern würden. Digitalität sei eine Revolution und wird Türen öffnen, die man jetzt noch gar nicht kennt, sagte Martin mit einer Begeisterung, die ich bei dem alten Kiffer gar nicht erwartet hatte. Wie üblich musste ich widersprechen. Es sei doch die Digitalität grundsätzlich etwas sehr Banales, nur eine andere Art der Beschreibung, durch die zweifellos manche technische und speziell mediale Prozesse vereinfacht werden könnten, aber die analoge Welt bot doch Lösungen für so gut wie alle Probleme. Hervorragende Lösungen, wie Röhrenverstärker und 35mm-Film, 8-Spur-Tonbandmaschinen und meine geliebte Schreibmaschine. Die meisten dieser hervorragenden analogen Lösungen konnten wir uns allerdings nicht leisten. Deshalb war ich angereist, wegen den billigen analogen Super-8-Filmen aus dem Osten, die wirklich einen ziemlich minderwertigen Ersatz darstellten, für das unerschwingliche professionelle Filmmaterial. Nichtsdestotrotz hielt ich dieses Medium in seiner Beschränktheit allen digitalen Spielereien überlegen. Das glaubte ich damals tatsächlich, was man rückblickend als naiv ansehen könnte, aber es waren ja wirklich nur ganz wenige Menschen, die den zunächst schleichenden Entwicklungsprozess der digitalen Informationstechnik in seiner Bedeutung richtig einschätzten. Ich gehörte nicht zu ihnen, aber da Martin mein Freund war, kannte ich also immerhin jemanden, der es schon recht früh kapiert hatte, während ich mich an meine Schreibmaschine klammerte und jahrelang behauptete, dass sie mir bei der Ausformulierung meiner vermeintlich kreativen Gedanken die beste Gefährtin sei. Dass ich sie auch auf einer einsamen Insel benutzen könnte, oder im Wald. Inzwischen ist die Hälfte meines Lebens rum, aber es hatte sich nie die Gelegenheit ergeben, dass ich auf einer einsamen Insel oder im Wald eine Schreibmaschine gebraucht hätte. Dafür sitzen dort inzwischen die Typen mit ihren Smartphones und Tablets. Damals, als wir im Wedding bei Florian diskutierten, widersprach ich Martin bei vielen seiner Thesen, an die ich mich im Detail gar nicht erinnern kann. Er erging sich in Visionen einer erweiterten Kommunikation, während ich von sozialen Netzwerken redete und damit etwas ganz anderes meinte, als heute mit dem Begriff verbunden wird. Schließlich kreiste dann doch noch ein Joint und das Gespräch drehte sich dabei um diverse Bars und Kieze, was mich schläfrig werden ließ. Ich rollte den Schlafsack aus, damit ich am nächsten morgen früh nach Ostberlin käme und eventuell gleich am Nachmittag zurücktrampen könnte. Mitkommen wollte Martin nicht, er konnte die Sozialisten nicht leiden, außerdem musste er was Wichtiges erledigen. Dass alle, die sich in Berlin aufhalten, permanent was Wichtiges zu erledigen haben, begriff ich erst, als ich dort wohnte. Damals dachte ich noch, es sei wirklich wichtig und machte mich nach dem Frühstück auf den Weg zum Bahnhof Friedrichstraße.
Langsam stieg meine Nervosität, obwohl ich mein Vorhaben in keiner Weise als kriminell oder moralisch fragwürdig ansah. Aber die Humorlosigkeit der DDR-Grenzer flößte mir durchaus Respekt ein. Vielleicht zu viel, denn es muss wohl meine Körpersprache gewesen sein, die die Aufmerksamkeit auf mich lenkte, so dass man mich bei der Einreise aus der langen Schlange der Wartenden herauspickte und sorgfältig untersuchte. Nicht nur mein Portemonnaie, sondern auch noch die Jacke und der Rucksack wurden durchstöbert. Natürlich nahm der Grenzer auch meinen Fotoapparat in die Hand, schenkte ihm jedoch keine weitere Beachtung. Anders war es mit der zusammengefalteten Fotokopie, die er in der Innentasche meiner Jacke entdeckte. Er faltete sie auf, runzelte die Stirn. Was das sei, fragte er mich. Ach du Schreck, ich wusste es auch nicht! Erst, als er mir den Zettel zum Lesen hinhielt, sah ich, dass es eine Seite aus meinem Drehbuch war. Ich war mit ein paar kopierten Seiten zu Martins Schwester gefahren, um mit ihr den Dialog zu besprechen. Dass eine Seite in der Jacke geblieben war, hatte ich gar nicht bemerkt. Jetzt stand ich da, ertappt als einer, der womöglich Propagandamaterial ins gelobte sozialistische Land hineinschmuggeln wollte. Das Wort Drehbuch lag mir schon auf den Lippen, doch ich verkniff es mir gerade noch. Wer Drehbücher schreibt, macht sich verdächtig, dachte ich, bestimmt waren die Grenzbeamten darin geschult, wer welche unlauteren Absichten in ihrem Land hegte und mein Vorsatz, mir durch Devisenkriminalität das wertvolle Filmmaterial zu ergaunern, das eigentlich dafür vorgesehen war, den verdienten Urlaub der Werktätigen und ihrer Familien zu dokumentieren, wäre leicht zu erraten, wenn ich ein Drehbuch in der Tasche stecken hätte. Theater, stotterte ich, ja, das war die richtige Idee, wer Theater spielt, braucht kein Filmmaterial und muss als potentieller Brecht-Fan ab und zu dringend nach Ost-Berlin. Das ist der Entwurf eines Theaterstückes, das wir in unserer Laienspielgruppe aufführen möchten, in Süddeutschland, erklärte ich. Das habe ich selbst verfasst, ich versuche mich als Schriftsteller. Der Grenzer schaute mich streng an, dann warf er einen langen prüfenden Blick auf den Text. Welche Seite des Drehbuchs war das überhaupt? Er blickte nochmal in meinen Reisepass. Hier in dem Text steht was von einer U-Bahn, wo ist die? In der Stadt, in der sie wohnen, gibt es keine U-Bahn. Das stimmte, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. War der Grenzkontrolleur im vorigen Leben Literaturprofessor oder Geograf gewesen? Wieso wollte der das so genau wissen? In Nürnberg gibt es eine U-Bahn, die ist ganz klein, aber es gibt sie, und Nürnberg ist gar nicht weit weg, also … unsere Laienspielgruppe probt in Nürnberg, manchmal. Oh Gott, der musste doch merken, dass ich nur phantasierte. Warten sie hier, sagte er und verschwand nach hinten.
Das ging ja gut los. Vor mir lag mein leerer Rucksack, daneben der Fotoapparat. Den hätte ich gerne weggesteckt, aber das durfte ich bestimmt nicht. Hinter dem Tresen, in einigen Metern Abstand, stand noch so ein strenger Grenzbeamter und fixierte mich. Links und rechts von mir wurden ab und zu weitere Touristen aus der Reihe herausgewunken und mussten ihre Taschen ausleeren. Aber da gab es wohl nichts Verdächtiges. Während ich noch wartete, packten die anderen ihren Kram wieder zusammen und gingen weiter, unbehelligt. Schließlich kam mein Grenzer zurück, drückte mir den Zettel in die Hand und meinte, es sei wohl doch eher privater Natur, aber ich solle bedenken, dass die Einfuhr von Schriftstücken, Zeitungen und Büchern gesonderten Regelungen unterliege und ich solche literarischen Werke in Zukunft zuhause lassen solle. Danke für die Belehrung. Ich ärgerte mich über meine Nachlässigkeit, schließlich war ich in geheimer Mission unterwegs, wieso hatte ich diesen Zettel gar nicht bemerkt?
Jetzt erschien mir mein Rucksack verdächtig. Es war ein grüner Segeltuchrucksack mit Ledergurten, der ohne Inhalt unauffällig und klein an meinem Rücken hing. Als ich dann im großen Kaufhaus am Alexanderplatz 25 Filmkassetten hineinsteckte, blähte er sich zu einer großen Kugel auf. Viel zu groß für einen Tagestouristen mit lauteren Absichten. Aber trotzdem war ich entschlossen, die Sache durchzuziehen. Was sollte ich denn auch sonst mit meinem schwarz getauschten Geld anfangen? Es blieb sogar einiges übrig und ich vertrödelte die Zeit auf der Karl-Marx-Allee, ging essen, trank schlechten Kaffee und kaufte mir ein blaues Lederportemonnaie. Dann zurück zum Bahnhof Friedrichstraße, wo ich mich gegen Mittag in die Schlange einreihte. Jetzt war hier viel los, jede Menge Menschen wollten rüber in den Westen. Wieder wurden die meisten ohne Prüfung des Gepäcks zur Passkontrolle durchgewunken, wieder wählte man stichprobenartig einzelne Personen aus, die genauer kontrolliert wurden, wieder fiel die Wahl auf mich. Das konnte doch nicht wahr sein! Aber es war offensichtlich passiert, sie hatten mich herausgepickt. Machen sie mal ihren Rucksack auf, sagte der Grenzer und da musste ich ihm meine Schätze zeigen. Die vielen Filme waren sehr verdächtig und meine Quittung vom Geldumtausch, die ich vorlegen konnte, wies nur den Mindestbetrag von 25 Mark aus. Kommen sie mit! sagte er mit einer Bestimmtheit, die keinen Widerspruch zuließ und brachte mich in ein spartanisches Kämmerlein mit vergittertem Fenster.
Er deutete auf einen Holzstuhl in der Ecke neben dem Fenster, auf den ich mich setzen und warten solle. Dann schloss er die Tür und ließ mich allein zurück. Den Rucksack, meine Reisedokumente, Portemonnaie, Kalender und Notizheft hatte er an sich genommen. Da saß ich ganz verwirrt und wenn ich mich erhob, was ich mich kaum traute, konnte ich vor dem Fenster die Menschen sehen, die sich auf den Tränenpalast zubewegten. Die wirkten alle unbeschwert, ganz im Gegensatz zu mir. Jetzt hatte mich die böse Staatsmacht festgesetzt. Was konnten die mir, als Abgesandten aus dem freien Westen, antun? Eigentlich nicht viel, oder doch? Konnten die mich in ihre schaurigen Ost-Gefängnisse einsperren, und wenn ja, wie lange? Nein, das war doch eine reine Angstphantasie, aber die würden mir die Filme wegnehmen und dann stand ich da, was aber auch nicht so schlimm wäre, denn für den kleinen Provinzfilmemacher wäre das ja eine Sensation, wenn man von höchster politscher Stelle aus meine Dreharbeiten blockierte, das verliehe mir eine Bedeutung im deutsch-deutschen Kulturkampf, der weit über die ästhetische Belanglosigkeit meines filmischen Werkes hinausreichte. Aber von höchster politischer Stelle konnte keine Rede sein, ich hatte mich zwar an einen Brennpunkt zwischen den Systemen vorgewagt, aber trotzdem war ich nur ein unbedeutender Student, der von einem ebenso unbedeutenden Grenzbeamten erwischt worden war.
Als er wiederkam, sah ich ihn überhaupt erst einmal bewusst an. Nicht jung, nicht alt, nicht groß, nicht klein, ein bisschen dicklich, blaue Augen, die übliche hässliche Metalldrahtbrille und etwas schiefe Zähne. Später würde ich so ähnlich aussehen, aber das wusste ich damals nicht und außerdem würde ich keine Metalldrahtbrille, sondern eine schwarze Intellektuellenbrille und erst recht nicht diese unsympathische graugrüne Uniform tragen, auch keine andere Uniform. Jetzt setzte sich der Grenzbeamte auf den zweiten Stuhl, zwischen uns das kleine Tischchen und begann mit der ersten Befragung. Wo die Filme herkämen. Aus dem Kaufhaus, Quittung war vorhanden. Wo das Geld herkäme. Hat mir mein Cousin gegeben. Wie heißt der? Wo wohnt der? Ich nannte Namen und den Ort. Das ist ja weit weg von Berlin und wieso gibt er ihnen so viel Geld? Weil ich ihm Kaffee aus dem Westen mitgebracht hätte. Für ein Päckchen Kaffee so viele Filme und dann fährt er bis nach Berlin? Er unterstützt meine künstlerischen Aktivitäten, der ist wirklich nett. Das darf er nicht, Devisenvergehen. Mein Cousin ist ein braver Bürger und Sozialist, ich habe ihn angestiftet.
Mir wurde immer mulmiger, denn der Grenzer glaubte mir diese Ausreden überhaupt nicht, außerdem: womöglich bekam meine liebe Ostverwandtschaft echte Probleme, wenn ich sie da hineinzog, und die mussten ja hier bleiben, mich würden sie bestimmt irgendwann wieder nach Hause lassen. Der Grenzer war korrekt, aber unerbittlich, immer wieder kam er mit den Fragen, die mich in Bedrängnis brachten und schließlich hielt ich es nicht mehr aus, da bekam er mein Geständnis. Schwarz getauschtes Geld, illegal ins Land geschmuggelt und mit meiner lieben Verwandtschaft hatte das gar nichts zu tun. Da schaute er mich an, als hätte er es schon immer gewusst und so war es wohl auch, denn er breitete meinen Terminkalender vor mir aus und zeigte mir meine eigene Notiz: 58 DM für Ostgeld stand da. So ein Mist! Was war ich für ein Idiot! Wieso hatte ich mir das eigentlich aufgeschrieben, so dämlich kann man doch nicht sein, aber ich war es, zweifellos.
Doch er ließ mir gar keine Zeit, mich über meine Dummheit aufzuregen, er machte mit den Fragen weiter, die der Auswertung meines Terminkalenders dienten, während ich, enthemmt durch das befreiende Geständnis und getrieben durch den Wunsch nach Selbstbezichtigung, keinerlei Widerstand mehr leistete, sondern geradezu geschwätzig über alle Aspekte meines Lebens, die irgendwie einen Niederschlag im Terminkalender gefunden hatten, Auskunft gab. An die Details konnte ich mich später nicht mehr erinnern, aber es ging aus unerfindlichen Gründen auch um Kriegsdienstverweigerung und mein Ingenieurstudium. Naja, dass ich mich, obwohl nur wehruntauglich, als Verweigerer des militanten West-Imperialismus zu positionieren versuchte, ging ja in meiner misslichen Situation zweifellos als harmlose Schleimerei durch. Wieso sich der Grenzer das alles anhörte, war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar, aber er verließ mich zwischendurch noch zweimal und ließ mich alleine in der Stube schmachten. Da wunderte ich mich durchaus, was die alles von mir wissen wollten, aber als er zum dritten Mal erschien, meinte er, dass die Chefs mit mir reden wollten und jetzt hätten sie Zeit für mich. Bei der Gelegenheit gab er mir meine Reisedokumente zurück, auch den Kalender und den Rucksack, allerdings ohne die Filme und das blaue Portemonnaie. Das stimmte mich optimistisch, irgendwie aus dem Schlamassel herauszukommen.
Erst recht, als man mich in ein holzvertäfeltes Zimmerchen mit einer für DDR-Verhältnisse geschmackvollen Sitzgruppe führte. Dort begrüßten mich zwei Herren. Einer im gleichen undefinierbaren mittleren Alter wie der Grenzer, der andere etwas jünger und eine recht sympathische Erscheinung, das Wort „schneidig“, das ja keiner mehr benutzt, passte bei ihm gut. Die beiden trugen keine Uniform, sondern Hemden mit Schlips und Sakko. Dann boten sie mir zu meinem Erstaunen Zigaretten an, Cabinet, was gut zu dem fensterlosen Raum passte. Ich solle mal erzählen, forderte man mich auf. Ich fand das merkwürdig, aber wenn sie sich das wünschten, konnte ich ihnen behilflich sein und bestimmt würden sie sich freuen, wenn ich meine unzusammenhängende Geschichte mit Kritik am Westen und Sympathie für den Osten würzte: dass ich einerseits studieren würde, um Ingenieur zu werden, andererseits wenig Gefallen am gut geschmierten Produktionsmechanismus des Kapitalismus hätte, dass ich mich als Filmemacher kritisch mit dem System auseinandersetzen würde, dass ich meine kleinen Devisenvergehen nicht als Affront gegen den Arbeiter- und Bauernstaat sähe, sondern als opportunes Hilfsmittel für meinen mit künstlerischen Mitteln ausgetragenen Klassenkampf, dass ich ab und zu demonstriere, allerdings gegen Atomkraftwerke, die der Sozialismus auch noch nicht abgeschafft hätte, dass meine Mutter im Westen lebe, aber manchmal „Ein Kessel Buntes“ im DDR-Fernsehen anschaue, weil sie das besser fände als das viele Gequatsche in unserem Fernsehen. Ich erzählte also jeden unbedeutenden Mist, sofern er ansatzweise der Wahrheit entsprach und meine Sympathie für die DDR zu belegen schien. Meine Gesprächspartner waren wirklich geduldig, was diese langatmigen Ausführungen anging, aber der schneidige Herr konfrontierte mich dann doch mit der berechtigten Erkenntnis, dass meine Aktivitäten recht beliebig seien. Um gegen das System vorzugehen, brauche man einen Gegenentwurf, ein Alternativsystem, denn einfach „dagegen sein“, das bringe nichts, das sei bloße Polemik. Ich schaute ihn groß an. Mir schien, als hätte er recht, als hätte er genau den wunden Punkt meines diffusen nonkonformistischen Mainstreamverweigerungsgezappels erkannt. Aber meine Hoffnung, ich würde noch mehr konkreten Erkenntnisgewinn aus der Unterhaltung ziehen, erfüllte sich nicht, denn er lenkte das Gespräch auf mein Studium und auf die Forschungsprojekte am Institut, was mich doch überhaupt nicht interessierte. Und er benutzte dabei zum zweiten Mal die Redewendung „Wir können ja in Kontakt bleiben.“ Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die wollten mich zu einen Stasi-Mitarbeiter machen und während das Gespräch sich um die langweiligen Uni-Gegebenheiten drehte, kristallisierte sich immer mehr heraus, worin das Missverständnis bestand. In meinem Terminkalender gab es unter anderem eine Notiz, die sich auf einen der wichtigsten bundesdeutschen Rüstungskonzerne bezog. Der Grenzbeamte hatte gedacht, dass ich dort ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum führen wollte, in Wirklichkeit war es nur eine Exkursion gewesen. Klar, das wäre ein Schnäppchen für die Stasi gewesen, wenn sie mich bei einem kleinen harmlosen Schmuggelversuch abgreifen und dann gelingt es mir, als Ingenieur bei der Waffenschmiede der Nation zu arbeiten. Aber daraus würde nichts werden, die nehmen mich doch gar nicht, weil ich nicht bei der Bundeswehr war, sagte ich. Ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich so richtig als Ingenieur arbeiten will. Das brachte den Stasi-Mann gar nicht aus der Ruhe, er betonte vielmehr, dass ich ja gerade dann, wenn ich ein alternatives Leben führen wollte, so einen kleinen Nebenverdienst zu schätzen wissen würde, der sich aus unserer Zusammenarbeit ergeben könnte, wenn wir „den Kontakt aufrechterhielten“ und meinen Freund, der nach Berlin ziehen würde, den könnte ich ja öfter mal besuchen und dabei würden sie mich unterstützen, na ja, nicht unbedingt mit Flugtickets, aber die Bahnfahrt wäre schon drin. Mannomann, die meinten das ja wirklich ernst! Aber die mussten doch sehen, dass ich völlig unfähig war. So stümperhaft, so dilettantisch, wie ich mich angestellt hatte, was sollte ich da für einen Nutzen für sie bringen? Oder verstanden sie sich doch als Kunstmäzene?
Wir müssen zum Ende kommen, dachte ich mir und rückblickend tat ich das einzig Sinnvolle: Ich sagte, dass ich etwas getan hätte, was falsch gewesen sei, doch dabei solle es bleiben, ich müsse mich jetzt dafür verantworten, aber ich wolle mich nicht noch in weitere Schwierigkeiten hineinmanövrieren. Zuletzt traute ich mich sogar, darum zu bitten, die Filme mitnehmen zu dürfen. Da doch das Filmprojekt schon geplant sei und ich das Material dringend brauche. Da holten sie tatsächlich eine Tragetasche, voll mit meinen Filmen und dem blauen Portemonnaie. Die gaben sie mir und wiesen darauf hin, dass ich bei meiner nächsten Einreise in die DDR erst einmal eine Geldstrafe begleichen müsste. Aber die Ausreise war gratis, die Filme waren bei mir, das Bewerbungsgespräch beendet. Ein Grenzer geleitete mich durch einen langen Flur, öffnete eine Tür und ich stand plötzlich inmitten der vielen Menschen, die sich von der Passkontrolle zum Bahnsteig bewegten, dann hinein in die S-Bahn und schon war ich im Westen.
Ich schaute auf die Uhr. Es ging gegen fünf. Hatte ich wirklich über drei Stunden im Tränenpalast verbracht? Offensichtlich schon. Es kam mir vor wie ein wirrer Traum, den ich aber nicht abschütteln konnte, er saß fest im Bewusstsein, während die Stadt an mir vorbeiglitt und ich schließlich durch die traurigen Straßen im Wedding ging, um Martin von meinem Erlebnis zu berichten. Der würde staunen, was ich alles auf mich nahm, um unseren Film zu drehen. Doch er staunte gar nicht, denn er war nicht da und Florian auch nicht. Niemand war da. Ich hockte in dem verranzten Weddinger Treppenhaus vor der verschlossenen Tür und wartete, dass jemand käme, der sich meine Geschichte anhören wollte. Waren sie alle bei ihren wichtigen Terminen? Ich fand es unerträglich, alleine dazusitzen und warten zu müssen.
Die Straßen rings um Florians Wohnung erwiesen sich als nichtssagend oder quälend hässlich, die Dönerbuden als unappetitlich und die Cafés waren voll mit Asozialen. Trotzdem entschied ich mich nach langer Ratlosigkeit für eine türkische Pizza, die nicht schmeckte, doch als ich danach zurück zu FloriansWohnung ging, öffnete er mir die Tür. Endlich jemand, der meinem extrem erhöhten Mitteilungsbedürfnis Linderung verschaffen konnte. Da es inzwischen schon spät war, bot mir Florian an, nochmal bei ihm zu schlafen. Martin habe sich ja eh abgemeldet, weil er bei seiner Freundin übernachten würde. Ach so? Dass Martin eine Freundin hatte, war mir gar nicht bekannt. Florian schob mir einen Zettel mit einer Telefonnummer hin, da könne ich Martin erreichen, und er hätte darum gebeten, ihm mitzuteilen, ob meine Mission geklappt hätte. Eigentlich war ich davon ausgegangen, Martin würde sich mit mir nach diesem Abenteuer ausgiebig betrinken, aber so wie Florian klang, ging es nur darum, Bescheid sagen und dann zügig nach Süddeutschland abzureisen.
Was ich dann auch machte, denn nachdem ich die Telefonnummer gewählt hatte, meldete sich völlig unerwartet Sabines Stimme. Ja, das sei ihre Nummer, die Telefonnummer, die zu ihrer Wohnung gehöre, wobei die Wohnung ziemlich klein sei, sie hoffe, noch etwas Besseres zu finden, aber immerhin sei es nicht im Wedding. Ob ich Martin sprechen wolle. Da hatte sie mich wirklich überrascht, es fiel mir nichts ein, außer Ja zu sagen und während ich dann Martin am Telefon hektisch und wirr erzählte, was vorgefallen war, versuchte ich gleichzeitig die Tatsache zu verarbeiten, dass Florian gesagt hatte, Martin sei bei seiner Freundin, gleichzeitig war er bei Sabine. Wenn A gleich B und B gleich C, dann ist A auch gleich C, oder etwa nicht? Logische Schlussfolgerung: Sabine war die Freundin. Oder hatte ich irgendwas verwechselt, gab es da noch andere Erklärungsmöglichkeiten? Alternativlösungen außerhalb der gängigen Logik? Während ich nach diesen Lösungen suchte, erzählte ich gleichzeitig von der Stasi und meinen Super-8-Filmen, das war ein extremer Gedankenstress. Als ich dann mit meiner Geschichte zum Ende kam und Martin mitteilte, dass sie mir die Filme zurückgegeben hätten, da sagte er nur „Wahnsinn“, dann schwiegen wir beide. Sollte ich fragen, ob Sabine seine Freundin sei? Ich tat es nicht, ich sagte, dass ich morgen früh nach Hause fahren würde, ob wir uns noch sehen würden? Vermutlich nicht, es sei zu erwarten, dass er nicht so früh aus dem Bett komme. Schon klar, dachte ich mir, er will mit Sabine also auch nach dem Aufwachen ficken, Mist. Vermutlich sei ich schon weg, wenn er kommen würde, fügte er hinzu, und ich fragte mich im Stillen, ob ich dies als Aufforderung verstehen sollte. Vermutlich ja, und deshalb sagte ich einfach OK, Gute Nacht, bis in einer Woche, Tschüss und legte auf.
Florian entkorkte gerade die Weinflasche. Auf meine Frage, ob Sabine Martins Freundin sei, antwortete er mit Ja, die würde ich doch kennen, die war damals auch auf der Premierenfeier bei Martin und danach sei es ziemlich schnell gegangen. Bei mir ging es auch ziemlich schnell: Mich zu betrinken. Florian hatte drei Flaschen Wein da, vermutlich trank ich zwei oder ein bisschen mehr davon, er den Rest und am nächsten Tag stand ich verkatert am Straßenrand und trampte nach Hause.
8
Es folgte eine öde Zeit. Zwar gelang es mir, mit der Rückbesinnung und einigen älteren Filmen mehrere Filmvorführungen in Jugendzentren, Kulturkneipen und Off-Kinos durchzuführen, außerdem lief die Rückbesinnung auf einem coolen Super-8-Open-Air-Festivals, aber mir schien, als verpuffe die Energie, die ich aus diesen Vorführungen schöpfte, gleich wieder, weil mir der falsche Film viel Mühe machte. Von Anfang an liefen die Dreharbeiten nicht so gut, wie erhofft und dann gefiel der fertige Film niemandem so richtig. Mir auch nicht. Meine Freunde, die so besessen von der Idee gewesen waren, verschwanden einer nach dem anderen aus meiner Universitätsstadt. Nachdem Martin erfuhr, dass er die Aufnahmeprüfung für die Akademie der digitalen Künste bestanden hatte, zog er innerhalb weniger Wochen nach Berlin, wo Sabine sowieso schon war. Achim fiel durch eine halbwegs wichtige Prüfung und schimpfte hinfort auffällig oft über die schlechten Studienbedingungen. Ein Semester später machte auch er sich auf den Weg nach Berlin. Dort, so sagte er zum Abschied, würde er als Studienabbrecher weniger auffallen, wenn es schlecht liefe, oder für den Fall, dass er das nutzlose Studium der Theaterwissenschaft bis zum Abschluss durchhielt, viele Möglichkeiten finden, hochqualifiziert in unbezahlten Kulturklitschen abzutauchen. Holger hatte zwar noch sein Zimmer in meiner WG, aber da er ein Referendariat machte, sah ich ihn oft Wochen lang nicht. Ich selbst hatte nach den Dreharbeiten für den falschen Film bereits mit den Vorbereitungen für die Diplomarbeit begonnen. Dadurch verbrachte ich mehr Zeit an der Universität und mit meinen Studienkollegen, die mit ihrer Vorliebe für handfeste Witze wenig an meiner konzeptuell motivierten Filmidee interessiert waren. Ich gab dem Werk den sperrigen Titel „Der falsche Mann zur falschen Zeit im richtigen Film“. Das machte es aber leider auch nicht wett, und so musste ich mir eingestehen, dass ich das künstlerische Niveau der „Rückbesinnung“ nicht erreicht hatte. Bisher war es mir gelungen, immer an die Qualität der Vorgängerfilme anzuschließen oder sogar besser zu werden. Vom „Falschen Film“ konnte man das nicht sagen. War die Idee eine Schnapsidee gewesen? Hatte ich zu viel auf die Ratschläge der anderen gehört, oder zu wenig? Hätte ich lieber Martin Kamera machen lassen sollen? Oder war ich überfordert, weil ich viel zu oft daran dachte, dass ich den Film hinter mich bringen sollte, um dann endlich mit der Diplomarbeit anzufangen? Nach dem Diplom würde es vielleicht gar nicht mit den künstlerischen Kurzfilmen auf Super-8 weitergehen, das war eine Schreckensvision, die mich einschüchterte.
Als die Premiere stattfinden sollte, war Martins Wohnung schon geräumt, darum kam ich auf die Idee, ich könnte die Premiere in dem Szene-Kino durchführen. Aber das war eigentlich zu groß, es wurde nicht voll, 200 Sitzplätze sind eben doch eine ganze Menge und die Leinwand war doppelt so groß, wie die Projektion meines Super-8-Bildes. Im Kino tranken die Leute auch nicht viel, zumindest nicht vor dem Film. Das wirkte sich alles auf die Stimmung aus. Es war es eine recht uncoole Veranstaltung, die bei mir das Gefühl einer verpassten Chance zurückließ, aber keineswegs zur Stärkung des Selbstvertrauens diente.
Die hätte ich aber durchaus gebrauchen können, da die Diplomarbeit mit einigen technischen Schwierigkeiten begann, mit Motivationsproblemen weiterging und in totaler Verunsicherung ihr Ende fand. Zum Glück widerstand ich allen Anfechtungen. Nervlich zunehmend zerrüttet wurschtelte ich mich durch entsetzlich lange neun Monate. Der betreuende Professor quälte mich mit etlichen gutgemeinten Ratschlägen. In schlimmen Momenten spielte ich mit dem Gedanken, alles hinzuschmeißen und auf das gesamte Diplom zu verzichten. Das wäre so kurz vor dem Ende des Studiums der totale Irrsinn gewesen, aber ich dachte mir, wenn ich der Welt zeigen will, wie sehr ich unter der Wissenschaft leide, dann kann ich das ja tun. Ich tat es nicht, raffte mich immer wieder auf und schleppte mich ins Institut, wo ich dann recht motivationslos weiterforschte, was vermutlich nicht nur mich, sondern auch den Professor frustrierte. Schließlich trat er die Flucht an und flog zu einem Auslandsaufenthalt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich unermüdlich über den Abgabetermin hinaus weitergemacht und gewartet, bis er zurückkommt, um ihm die letzten Korrekturen auf einem silbernen Tablett zu servieren. Aber danach stand mir der Sinn überhaupt nicht. Wenn er verschwindet, warum sollte ich nicht auch abhauen? Inzwischen hatten nicht nur meine Filmfreunde, sondern auch die meisten der Mitstudenten meines Jahrganges die Stadt verlassen. Ich hatte mit der Diplomarbeit spät begonnen und sie zog sich länger hin, als bei den Kommilitonen. Während ich am Zusammenschreiben war, bekamen sie schon ihre Bewerbungen zurück und verteilten sich im ganzen Bundesgebiet. Das kleine Häuflein meiner Freunde und Bekannten in der Universitätsstadt schrumpfte immer weiter und das stimmte mich missmutig.
Kaum meldete Tina, dass sie eine viel zu große Wohnung für wenig Geld irgendwo auf dem Land bezogen habe und dringend einen Beistand brauche, der ihr nicht nur die Leere des Wohnraumes, sondern auch das Nichts, das auf einen Studienabbruch folgt, möglichst anregend und zukunftsorientiert anfüllt, da packte ich umgehend meine Sachen zusammen und verpisste mich.